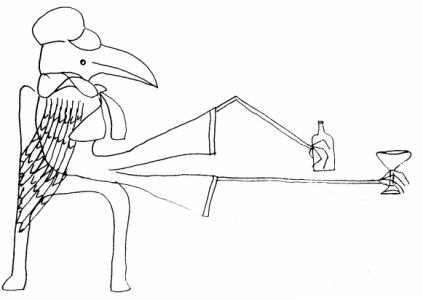
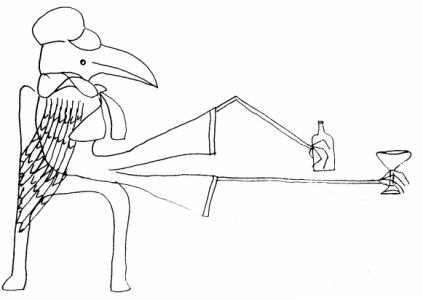
Miriam Loewy
Wer niest denn da?
Als kleines Kind nahm ich ihn nicht als ganzen Menschen wahr, nur seine weichen Hände und seinen Kopf mit den schönen braunen Augen hinter der Brille, seine fleischige Nase und seine blanke Glatze. Seine Hände, mal die rechte, mal die linke, waren es, die mich in den Jerusalemer Zoo führten, fast an jedem Wochenende.
Das hat noch heute zur Folge, daß ich spontan an ihn denken muß, wenn ich eine Robbe, einen Raben oder eine Schildkröte sehe; das waren seine Lieblingstiere.
Wenn er Zeit für mich hatte, gab es nur ihn und mich. Wir gingen in der gleißenden Sonne Jerusalems Hand in Hand und unterhielten uns. Wir sprachen miteinander über den Himmel, die Erde, die Tiere und über Dinge, die ich nicht ausstehen konnte. Denn wenn ich etwas nicht wollte, war er der einzige, der es akzeptieren konnte und der sogar etwas Gesundes in meiner Kinderwut sah. Er selbst konnte so jähzornig werden, wenn er irgendeiner Art von Unanständigkeit begegnete, daß er am ganzen Körper zitterte und wir alle Hände voll damit zu tun hatten, ihn zu beruhigen. In diesem Zusammenhang stand auch seine Galle, auf die man achten mußte und von der gesagt wurde, daß sie ihm hochkäme, wenn man ihn ärgert. Etwas Genaues konnte ich mir darunter nicht vorstellen, so was wie eine grüne Handgranate vielleicht.
Später wurde ihm die Galle herausgenommen und ab da aß er täglich einen Haferbrei zum Frühstück, ich nahm an, damit sie nicht nachwächst. Und immer wenn es darum ging, ihn zu schonen, hieß es auch, er könne auf Akazien klettern. Das wurde aber nur so gesagt, denn ich habe ihn nie klettern sehen.
Mein Großvater war ein zierlicher, kleiner Mann. Sein Gehstock, den er schon in jungen Jahren immer bei sich hatte, obwohl er keine Gebrechen hatte, war ein Statussymbol, ebenso wie sein grauer Hut.
Gespielt hat er mit mir nie. Er war nicht verspielt. Er nahm keine besondere Haltung ein, wenn er sich mir widmete. Ja, er widmete sich mir, er war neugierig auf meine kindlichen Entdeckungen und immer bereit, mir Zusammenhänge zu erklären, ohne auch nur eine Spur langweilig zu sein.
Er hatte große Ohren und konnte mir stundenlang zuhören, so genau zuhören und so interessiert, daß ich ihm gerne eigens für ihn erfundene Geschichten erzählte und ihm gern zuhörte, auch wenn er sich weigerte, eine kindgemäße Sprache anzunehmen.
Er sah mir Dinge nach, die meine Mutter und Großmutter mir nicht nachsehen wollten, und wenn sie ihn darauf hinwiesen, daß er unpädagogisch sei, nannte er mich seinen „Herzensdieb”. Regelmäßig, wenn das Wort fiel, sahen wir uns wie zwei Verschworene an und keiner konnte uns etwas...
Wenn er las oder arbeitete, ich konnte es noch nicht unterscheiden, stützte er seinen Kopf in seine rechte Hand und klopfte versunken mit den Finger auf seine Glatze, die damals schon Pigmentflecke hatte.
Die Familie drumherum, meine Großmutter, meine Schwester und ich wagten es nicht, ihn, wenn er las, zu stören. Zum Kaffetrinken holte meine Großmutter ihn jeden Tag um punkt fünf in die Küche, wo ein großer Tisch stand, auf dem für uns Kinder Süßgebäck und für ihn Salzgebäck stand.
Während dieser Kaffestunde wurden die alltäglichen Notwendigkeiten besprochen, mit meiner Großmutter in Deutsch, mit uns Kindern auf Hebräisch.
In Jerusalem arbeitete mein Großvater als Kassierer in einer Versicherungsfirma. Daß er Anwalt war, erfuhr ich erst später. Für Anwälte, die aus Deutschland stammten, gab es im damaligen Palästina keine Verwendung. Meine Großeltern waren 1936 vor den Nazis nach Palästina geflohen, nachdem mein Großvater seine Arbeit als Richter am Oberlandesgericht Celle verloren hatte, weil er Jude war, ihm die Promotion durch die Nazis nachträglich aberkannt worden war und ehemalige Arbeitskollegen und Nachbarn ihn aus Feigheit nicht mehr kennen wollten.
Als Versicherungskassierer in Jerusalem war mein Großvater unglücklich, aber er ging jeden Morgen mit einer zerschlissenen Aktentasche aus der Wohnung, einer Souterrainwohnung, aus deren hochgelegenem Fenster ich immer die Beine der Vorbeigehenden sehen konnte. Dicke Beine, dünne Beine, Männerbeine, Frauenbeine, Sommerbeine und Winterbeine. Manche Beine liefen schnell, manche gingen langsam, und am schönsten war es, wenn ich die drei Beine meines Großvater sah, seine beiden eigenen und seinen Gehstock, wenn er von der Arbeit nach Hause kam.
Im Haushalt meiner Großmutter, es war wirklich ihr Haushalt, dem sie im wörtlichen Sinn vorstand, lebte er eher mit seinen Büchern, zurückgezogen und still.
Als ich sieben Jahre alt war, in der Aera Adenauer, wurde er gemeinsam mit noch zwei anderen aus Deutschland geflüchteten Rechtsanwälten beauftragt, in Berlin die Wiedergutmachungsinstitute aufzubauen. Obwohl er über seine Arbeit als Kassierer sehr unglücklich war, machte er sich die Entscheidung, nach Deutschland zurückzugehen, nicht leicht.
Er war so enttäuscht von den Mitmenschen seiner Heimat, daß er sich nach dem Krieg geschworen hatte, nie wieder deutschen Boden zu betreten.
Aber andererseits waren das Angebot der israelischen Regierung, ihn in Deutschland für das Recht der Verfolgten arbeiten zu lassen, und vor allem die Möglichkeit, wieder anwaltlich tätig zu werden, so verlockend, daß er nicht widerstehen konnte. So wanderten meine Großeltern wieder nach Deutschland aus, von wo wir hin und wieder Post bekamen, gute Schokolade, schöne Kleider und liebevolle Briefe.
Als ich 11 Jahre alt wurde, luden meine Großeltern meine Mutter, meine Schwester und mich nach Berlin ein.
Sie bewohnten im schönen Stadtteil Dahlem eine kleine Dreizimmerwohnung. Die Wände waren mit Bücherregalen vollgestellt, ein Arbeitszimmer mit einem riesigen Schreibtisch war die Festung meines Großvaters, der morgens ins Büro oder zum Gericht ging, abends Artikel für die Neue Juristische Wochenschrift verfaßte und der nun alle Mühe hatte, den Lärm, den meine Schwester und ich veranstalteten, auszuhalten. Die Zeiten des Zoobesuchens in Jerusalem waren vorbei. Nun brach die Zeit der Kulturvermittlung über mich herein, was nicht einfach war, weil ich kein Wort Deutsch sprach. So versuchte mein Großvater mir zu erklären, wer Goethe ist, von dem ich in Israel bis dahin nichts gehört hatte. Er tat es so emphatisch, daß ich eine Zeitlang dachte, Goethe sei der Gott der Deutschen und „Ach, Du meine Güte”, sei eine Anrufung dieses Gottes eben, in Koseform. Formen spielten plötzlich eine große Rolle in unserem Leben, ‘Bitte’ und ‘Danke’ sagen war wichtig, ja, wir sollten sogar einen Knicks machen, wenn wir Erwachsene begrüßten und leise sprechen, bitte, Kinder, leise sprechen.
„Hans Sachs war ein Schuster und ein Dichter dazu” und ein Opernbesuch blieb uns auch nicht erspart, was bedeutete, sich fein anzuziehen und fast drei Stunden stillzusitzen in einer pompösen Opernarena, in der erwachsene Menschen sich leise ein Fernglas reichten und selbst in der Pause nur flüsternd miteinander sprachen.
Zu diesem Opernbesuch hatte mein Großvater uns zwar eingeladen, mitgekommen ist er aber nicht, weil Musik wohl das einzige war, was nicht zu seiner Welt gehörte. Nein, nicht nur die Musik, auch die Erotik gehörte nicht in seine Welt, das merkte ich immer daran, daß, wenn er mich in die Wange zwickte, um mich zu liebkosen, der Schmerz manchmal so stark war, daß ich seine warme, weiche, tolpatschige Hand wegschlug.
Auf seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer türmten sich die Aktenordner, hinter denen man ihn kaum ausmachen konnte. Seine Hand an der Glatze, die klopfenden Finger und eine falsch gepfiffene Melodie, manchmal war es eine Marschmelodie aus dem ersten Weltkrieg, den er als Soldat erlebt hatte, verrieten, daß er da war.
Zu der Zeit fing er an, eine Schwerhörigkeit zu entwickeln, die es, wie wir glaubten, nicht wirklich gab, sondern die nur ein Schutzwall gegen unsere Störungen und die zu häufigen Ablenkungen seitens unserer Großmutter sein sollte. Denn manchmal haben wir ihn dabei erwischt, daß er uns gehört hatte, obwohl wir geflüstert hatten.
Seine Sekretärinnen aus dem Entschädigungsamt nannten ihn „den zerstreuten Professor”, weil er oft etwas verlegte oder vergaß. Deshalb hatte er zwei Brillen, eine für das Büro und eine für zu Hause, zwei Schlüsselbunde und zwei Schals. Hatte er zu Hause einmal etwas verlegt, so bot er uns, oder genauer, demjenigen, der es finden würde, einen Groschen an.
Je länger die Suche dauerte und je kürzer seine Geduld wurde, um sehr mehr Groschen wurden für den Finder ausgelobt. Abwechselnd sorgten meine Schwester und ich dafür, daß verlorengegangene Gegenstände nicht zu schnell wiedergefunden wurden.
Seine Stimme hallte durch die kleine Wohnung, aus der Festung hinter dem Schreibtisch, wenn einer von uns erkältet war, nieste oder hustete: „Wer niest denn da?”
Meine Großmutter, meine Schwester und ich sahen uns dann achselzuckend an und Großmutter sagte geduldig: „Niemand stirbt, keiner ist krank, es war nur ein Juckreiz in der Nase”. Er war ein Hypochonder, und die Erwachsenen sagten über ihn, er müsse nur in einem Film einen Mann im Regen mit Regenschirm spazieren gehen sehen, um prompt die Grippe zu bekommen.
In ihrer kleinen Wohnung in Dahlem hatten meine Großeltern eine Haushälterin, die 5 Tage in der Woche den Haushalt betreute, und eine Hausärztin, die jeden Donnerstag, frühmorgens eine Visite machte, Medikamente verordnete, den Puls maß und meinen Großvater nach seiner morgendlichen Lektüre fragte: „War es heute Griechisch oder Lateinisch, Herr Doktor?” Und er antwortete: „Morgens Griechisch und abends Lateinisch, Frau Doktor.”
In der Familie wurde entschieden, daß wir in Deutschland bleiben. Das bedeutete, daß wir hier eingeschult wurden und gleichzeitig Deutsch und Latein lernen mußten, und das war schon deshalb nicht einfach, weil die hebräische Sprache von rechts nach links geschrieben wird, unverbundene Buchstaben hat und keine Groß- und Kleinschreibung. Das Sprechen lernten meine Schwester und ich sehr schnell, aber das Schreiben war ein Problem.
Mein Großvater ging dazu über, mit mir Deutsch zu sprechen. Um mir die Groß- und Kleinschreibung nahezubringen, sagte er mir solche Sätze, wie „das macht die Liebe” und „die Macht der Liebe”.
Mich interessierte dabei der Inhalt dieser Sätze viel mehr als ihre Form und ich versuchte, ihn in Diskussionen zu verwickeln; er blieb aber bei seinen Übungen und ich verstand und verstand es nicht. Auch die Sache mit den Artikeln ‘der, die, das’ wollte nicht in meinen Kopf.
„Ich habe kein Gehirn aus Gummi”, sagte ich ungeduldig. „Nein, aber aus Kautschuk”, antwortete er lachend und freute sich über jeden kleinen Fortschritt.
Es gab da den Spruch zu bearbeiten: „Der Eine sagt, was kommt danach, der Andere, ist es recht, und also unterscheidet sich der Herr so von dem Knecht”. Seine Interpretation hatte mit meiner nichts gemein, ich konnte damit nichts anfangen. Die letzten Knechte, von denen ich gehört hatte, waren die Juden in ägyptischer Gefangenschaft, bevor Moses sie durch die Wüste nach Kanaan führte. Diese Knechte waren Sklaven und durften ihren Herren nicht widersprechen, und so mußte mein Großvater, und er tat es auch, weit ausholen, um mir hiesige Knechtschaftsverhältnisse näherzubringen. Und so nahe er sie mir auch brachte, sie blieben mir fremd.
Nicht selten hatte ich damals den Eindruck, daß mein Deutschlehrer in der Schule und mein Großvater kollaborierten. Unter meine mißlungenen Aufsätze schrieb der Lehrer: „Kleines Mädchen, hab Geduld, wir sind alle beide schuld”.
Wütend überfiel ich meinen Großvater nach der Schule, mit meinem Deutschheft in der Hand: „Der hat mich schon wieder nicht verstanden, dieser blöde Lehrer, guck mal”. Und er las meine gequälte Handschrift, entdeckte, daß ich „Dachrinne” als „Dachrinde” geschrieben hatte und versuchte gegen meine sehr eigene Logik respektvoll und umsichtig Korrekturen anzubringen.
Er war ein Zweitagejude, so nennt man die Juden, die nur an zwei Tagen im Jahr in die Synagoge gehen, nämlich am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, und zu Neujahr, Rosch Haschana, was wörtlich Kopf des Jahres heißt.
Eigentlich hatte er Gott in der Nazizeit verloren, denn der Gott, der so etwas zuläßt, muß etwas anderes für wichtiger gehalten haben, und mit so einem Gott wollte mein Großvater nichts mehr zu tun haben, aber eben doch mit der Tradition.
Durch seine Arbeit, er mußte die grausamsten Mordakten aus der Nazizeit durcharbeiten, um Hinterbliebenen der Shoa zu ihrem Recht zu verhelfen, war die deutsch-jüdische Geschichte ein häufiges Thema unserer Gespräche.
Denn so, wie er Gott verloren hatte, hatte er auch seine Zugehörigkeit zum deutschen Volk, seine Heimat und sein Vertrauen verloren. Die Tatsache, daß er Unfaßliches in die Sprache der Juristen bringen mußte, Paragraphen finden mußte, Schriftsätze verfassen, die den Überlebenden ein „Restleben” ermöglichen sollten, machte ihn oft bitter und zuweilen wütend. Er ermahnte mich, ich war damals schon 15, niemals Befehlen zu gehorchen, mich niemals einer Meute anzuschließen, einem Beschuldigten immer Gehör zu verschaffen und „im Zweifel für den Angeklagten” einzutreten.
„Sei nicht zu faul, auch für andere das Wort zu ergreifen, und wo Unrecht geschieht, schau nicht weg”.
1888 ist er in Celle bei Hannover als ältester von fünf Geschwistern, drei Jungen und zwei Mädchen, geboren. Bei der Geburt seiner jüngsten Schwester, er war damals 14 Jahre alt, starb seine Mutter. 1911 legte er an der juristischen Fakultät der Universität Göttingen, er war damals 23 Jahre alt, seine Doktorarbeit zum Thema „Die Verteidigung gegen die Condictio sine causa durch Berufung auf ein fremdes Rechtsverhältnis” vor.
Ungerechtfertigte Bereicherung, fremdes Rechtsverhältnis, alles Worte, die gut zu seiner späteren Arbeit im Zusammenhang mit dem Naziunrecht passten.
Er hieß Manfred Herzfeld und sein Herz war mein Feld, ich konnte zu keiner Zeit verstehen, daß ihn Menschen als ernst und streng empfanden. Er war gerecht, und wenn es darauf ankam, konnte er laut werden. Sehr laut.
Angst hatte ich nie vor ihm, nur ein einziges Mal furchtbare Angst um ihn: Wir Kinder bekamen von den Großeltern monatlich 30.- DM Taschengeld. Als meine Großmutter mir, weil ich frech war, das Taschengeld sperren wollte, wurde ich noch frecher und sagte ihr, daß sie das gar nicht könne, weil wir das Geld eigentlich vom Großvater bekämen. Das war der einzige Fall an den ich mich erinnere, in dem sie ihn, was unsere Erziehung anging, aufforderte sich einzumischen.
Er kam in mein Zimmer und schrie mich an, was mir einfiele, die Gültigkeit des Wortes meiner Großmutter anzuzweifeln, er schrie und zitterte so vor Wut, daß ich Angst um ihn hatte und Schmerz darüber verspürte, daß ich ihn so in Rage gebracht hatte. Er drohte zu bersten. Andererseits hatte er mir beigebracht, nicht feige zu sein. Also sagte ich: „Opa, Du bist ungerecht, Du hast mich noch nicht einmal angehört!” Augenblicklich hielt er inne, drehte sich um und verließ mein Zimmer. Erst abends kam er auf den Vorfall zurück und bat mich, meine Sicht der Dinge darzustellen.
Ein paar Tage später hörte ich, wie er meiner Großmutter leise sagte: „Aber die Hauptsache ist, daß sie begriffen hat, daß man Beschuldigte anhören muß”.
Meine Mutter erzählte mir, daß mein Großvater, als sie noch ein Kind war, ebenso liebevoll mit ihr umgegangen sei, das hätte aber schlagartig aufgehört, als ich auf die Welt kam. Sie sagte nicht ohne Traurigkeit: „Er hat das ganze Paket Liebe, das er immer für mich hatte, ersatzlos weggenommen und auf Dich übertragen.”
Auch sie hatten ein Spiel mit Münzen, das sich aber von unserem späteren in Berlin unterschied. Mein Großvater ging mit meiner Mutter an jedem Wochenende angeln. Auf dem Weg zur Angelstelle sammelte meine Mutter Regenwürmer als Köder für die Fische, und für jeden Wurm gab es einen Groschen. Um ihren Profit zu steigern, ließ meine Mutter die Dose mit den Regenwürmern fallen und so gab es für die wiedergefundenen Würmer zusätzliche Groschen...
Als ich in Berlin an der Freien Universität schon eine Arbeit hatte, rief ich meine Großeltern täglich an, um zu hören, wie es ihnen geht, was die Ärztin meint, ob eine Kur geplant ist oder ein Theaterbesuch, ob sie etwas brauchen oder auch nur, um ihnen über meinen Liebeskummer zu berichten.
Jetzt hatte auch ich ein Kind, einen Sohn, und ich erlebte, wie mein Großvater seine ganze Liebe auf mein Kind übertrug. Er schaute in den Kinderwagen und sagte: „Wachs, lieber Junge, dann werden wir Goethe gemeinsam lesen und über Aristoteles sprechen...”
An einem Donnerstagmorgen im August 1968, der Donnerstag war der Tag der morgendlichen Arztvisite, rief mich meine Großmutter sehr ruhig in meinem Büro in der Freien Universität an: „Der Opa wird heute sterben, hat die Ärztin gesagt, sie hat ihn untersucht, jetzt liest er noch seine Post durch, er ist noch im Bett.” „Das ist Quatsch”, antwortete ich, „wie kann sie so etwas wissen, es geht ihm doch gut, oder?” „Ja, Kind”, sagte meine Großmutter ernst, „es geht ihm gut, aber ruf Deine Mutter in Hamburg an und sag ihr, daß ihr Vater heute sterben wird”. Sie legte den Hörer, auf und mechanisch wählte ich die Telefonnummer meiner Mutter und sagte mit den Worten meiner Großmutter:
„Dein Vater wird heute sterben, das hat die Ärztin gesagt, sie hat ihn untersucht, es geht ihm aber gut, er liest seine Post durch...”
„Quatsch”, hörte ich meine Mutter am anderen Ende sagen, „wie kann sie so etwas wissen?” und sie legte den Hörer auf.
Ich bat einen Freund, mich abzuholen, und rannte die Treppe zu der kleinen Wohnung meiner Großeltern hinauf. Die Haushälterin öffnete mir die Tür. „ Es ist passiert, es ist gerade passiert,” flüsterte sie aufgeregt. Meine Großmutter stand abwesend in der Küche und ich ging ins Schlafzimmer, wo mein Großvater regungslos im Bett lag. Er war gelb, sein Gesicht war schön, die Nase etwas gebogen, überhaupt nicht mehr fleischig. „Opa”, sagte ich leise und küßte sein vertrautes, friedliches Gesicht.
Den Schmerz, wie wenn ein Band zerreißt, empfand ich ein paar Stunden später, als die Mitarbeiter eines Beerdigungsinstitutes meinen toten Großvater abholten. Ich sah jeder Bewegung dieser Menschen zu, die ihn aus seinem Bett hoben und in den Sarg legten. Als sie den Sarg anhoben, um ihn die Treppen hinunter zu tragen, gab es einen dumpfen Stoß an die Wand des Sarges, als wäre Holz auf Holz gestoßen. Erst da war mir klar, daß mein Großvater nicht mehr ist.
Er hat mir die erste konkrete Begegnung mit dem Tod leichtgemacht, dachte ich. Er ist zu Hause ohne Qual gestorben, friedlich.
Ich setzte mich zu meiner Großmutter in die Küche und fragte sie: „Erinnerst Du Dich noch, wie er gelacht hat, als Fritz Teufel von der Berliner Kommune vom Richter aufgefordert wurde, sich vom Platz zu erheben, weißt Du noch, wie Opa gelacht hat, weil der Teufel die Aufforderung des Richters mit der Bemerkung quittierte: ‘Na ja, wenn es der Wahrheitsfindung dient’?”
Da war ein kleines liebevolles Lachen in unserem Weinen.
Nicht zufällig bin ich heute mit einem Mann verheiratet, der mindestens 15 Eigenschaften meines Großvaters hat, außer der Glatze.
ENDE