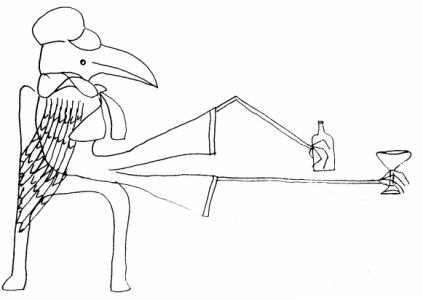
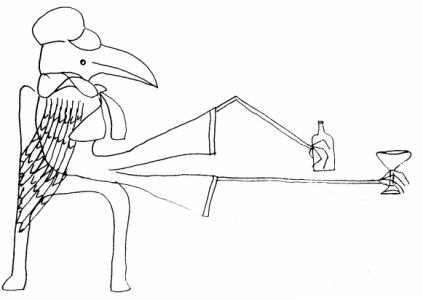
Miriam Loewy
Café Pinguin
Meine Mutter, -Gott hab sie selig-, die deutsche Jüdin, die mit sechzehn Jahren aus Nazideutschland geflohen war, hatte in der nordisraelischen Stadt Nahariya, wo wir wohnten, als ich 11, meine Schwester neun und meine Mutter 36 Jahre alt waren, scheinbar nichts Besseres zu tun, als meine kleine dicke Schwester und mich unzartes Wesen in den Balettunterricht zu stecken. Eine absurde Idee, wenn man bedenkt, daß es in Nahariya im Sommer bis zu 35 Grad Celsius im Schatten gibt, wenn man bedenkt, daß wir eigentlich gar kein Geld für solche Sperenzchen hatten und uns viel lieber mit der Jugendgruppe am Strand fläzten, und wenn man weiß, daß Ballett zu damaligen Zeiten ein ausgesprochenes Hobby der Elitären war, zu denen wir nicht im entferntesten gehörten.
Meine Mutter war vor ihrer Flucht aus Deutschland Tanzschülerin bei Mary Wigmann, sie mußte den Start in eine Tanzkarriere aufgeben und hoffte wohl in der besagten kleinen nordisraelischen Stadt Nahariya einen Funken der Tanzkunst auf uns Kinder überspringen lassen zu können.
Die Tanzmeisterin, auch eine emigrierte deutsche Jüdin, Frau Professor Ludwig war eine ältere, schlanke, große Frau mit einer sehr geraden Haltung, einem zerfalteten Gesicht und verwitterten Händen. Ihre Größe und ihre gerade Haltung machten es oft, daß meine Schwester und ich uns wie kleine runde Kobolde vorkamen, wenn wir ihr gegenüberstanden. Zweimal in der Woche also fanden wir uns widerwillig in ihrem Souterrainatelier wieder, vor langen Spiegeln uns an Holzstangen festhaltend, den Bauch eingezogen, den Hintern ausgestreckt, den Kopf hochnäsig und Grazie in den Händen, Kinder, rief sie kommandierend, Grazie in den Händen...
Ungefähr ein Jahr lang quälte uns die stolze und strenge Frau Professor Ludwig mit dem Kaiserwalzer, Chopinstücken und Peer Gynt, mit ausholenden und einschmelzenden Bewegungen, die nichts mit unserem robusten Alltag zu tun hatten und die fast wie ein zweites, heimliches Leben waren. Meine Mutter trat jeder Bettelei um Gnade und Befreiung mit einem gegrumelten , nein, ihr bleibt dabei, einwenig Kultur muß sein! entgegen.
Eines Tages teilte unsere Lehrerin uns mit, daß wir nunmehr reif für einen öffentlichen Auftritt seien, die nächsten drei Wochen wird ausschließlich der Kaiserwalzer geübt und dann öffentlicher Auftritt im Café Pinguin, einem der ältesten Cafehäuser in Israel überhaupt und dem Cafehaus, das die Stadt Nahariya landesweit bekannt gemacht hat und ein Wochenendanziehungspunkt für Gäste aus allen Landesteilen war. Dieses Cafehaus war von einer Familie Oppenheimer gegründet worden, emigrierten deutschen Juden, die mit uns entfernt verwandt waren.
Wir flogen und donnerten abwechselnd zu den Klängen des Kaiserwalzers durch das Souterrainatelier, mit viel anstrengender Grazie in den Händen, wir hatten inzwischen zur Belohnung für bestandene Qualen weiße Ballettkleidchen mit Tüllröckchen und rosa Ballettschuhe mit abgeflachter Spitze, was beim Spitzentanz einen stechenden Schmerz in den Zehen verursachte, wir waren komplett. In der Stadt wurden an Häuser und Bäume schöne Plakate angebracht, die verkündeten, daß die Tanzeleven der Frau Professor Ludwig am kommenden Schabbat im Garten des Café Pinguin auftreten werden.
Meine Schwester und ich, die Kaiserwalzersolistinnen, sprangen mit viel Grazie in den Händen in den Kaiserwalzer und auf die Bühne, wir flatterten in den gelernten Figuren von der Musik getrieben, sahen einander nicht, füllten hüpfend Leerräume und verbeugten uns am Ende, von liebevollem Elternapplaus aufgefangen. Als ich mit schmerzbrennden Füßen zu meiner Mutter ging und sie fragte, wie wir waren, sagte sie trocken: elefantös. Das wars dann auch, kein Ballett mehr und Café Pinguin nur noch zum Eisessen gehen,- Freiheit!
1981, 36jährig, bin ich nach 25 Jahren Aufenthalt in Deutschland nach Israel zurückgegangen, ich lebte in Tel Aviv, wo ich bei einer deutschsprachigen Zeitung arbeitete. Meine Wochenenden verbrachte ich oft in Nahariya, bei alten Schulfreunden und Verwandten. So kam es, daß an einem dieser Wochenenden der alte Ernst Oppenheimer mich fragte, ob ich nicht die Geschäftsführung seines Café Pinguin übernehmen wolle.
Es war mit den Jahren ein sehr großes Cafehaus geworden, von Unosoldaten, die im Südlibanon stationiert waren, gern besucht, von den Touristen aus dem Ausland und von den Urlaubern im Lande. Die Damen des ältesten Gewerbes waren nun im Pinguin ebenso zu Hause, wie Geschäftemacher, die den Unosoldaten Utensilien verkauften, die im Südlibanon nicht zu kriegen waren. Bis zu 2.000 Gäste am Tag gibt es hier, sagte der Alte, man muß auf alles achten, 40 Leute Personal, überleg es Dir mal.
In Tel Aviv, vom Wochenende in Nahariya heimgekehrt, erzählte ich einem befreundeten Restaurantbesitzer von dem tollen Angebot in Nahariya, gestand ihm aber gleichzeitig, daß ich von der ganzen Branche nicht einen Schimmer von Ahnung hätte, weder wüßte, wie man an einer Esspressomaschine an der Bar arbeitet, noch wie man die Kassen und die Kassenbons abrechnet, noch wie man das Personal einteilt und mit ihm umgeht. Macht nichts, sagte mein Freund, Du bist eine Frau mit Eiern, Du schaffst es...
Der Buchhalter und Berater der Leitung des Café Pinguin begutachtete mich einen ganzen Tag lang, um nach meiner Zusage für die Geschäftsführung meinen Wert im Monatslohn festzulegen. 40 Menschen Personalbestand, davon 38 Männer und zwei Frauen, mich dazugerechnet drei Frauen. Die fünf Kellner, das sogenannte Frontpersonal, bestand aus fünf marokkanischen Männern, die mit allen Wassern gewaschen waren und die meine Ahnungslosigkeit sofort registrierten. Der eine Große, Dicke, David, sah, als ihm mitgeteilt wurde, daß ich ab jetzt seine Chefin wäre, herablassend über seine Schulter zu mir herunter und lachte mir schallend ins Gesicht. Sein Gesicht war das eines Riesenbabys mit verschlagenen Augen, er war flink und phlegmatisch zugleich, wie ein Kamel mit einem Knick in der Bewegung. In der Küche arbeitete still und fleißig schon seit dreißig Jahre Fanny, die marokkanische Köchin, die ihre Seele für das Unternehmen gab, ihre Hände waren vom ewigen Walken, Schälen, Garnieren und Herrichten von feuchten Mahlzeiten feuerrot, ihr Haar war fettig und ihre Hüften stämmig. Abdu, der arabische Koch, der nach 15 Jahren Zugehörigkeit Krautsalat, Sachertorte und andere europäische Süßspeisen bereiten konnte, sah aus wie ein amerikanischer Schauspieler, mit einem dünnen Oberlippenbart und blauschwarzem Haar, im verschmutzten weißen Kittel, wie ein amerikanischer Schauspieler, der in diese Riesenküche geflohen war, vielleicht vor den vielen Verehrerinnen...
Chaim, das Faktotum oder der Hausmeister, ein kleiner, wieseliger sechzigjähriger Mann, der für all das zuständig war, wofür keiner zuständig war, kam nach dem ersten Weltkrieg aus Galizien nach Israel und arbeitete jetzt auch schon mehr als 25 Jahre im Pinguin.
Sie alle beäugten mich achselzuckend, sich selbst fragend, ob der Oppenheimer verrückt geworden sei, ihnen so ein grünes Pflänzchen aus Europa vor die Nase zu setzen. Schon eine Woche vor dem abgemachten Dienstantritt schlich ich mich in die verschiedenen Abteilungen ein, bat diesen und jenen Mitarbeiter um Auskunft über seinen Bereich, um Tips und Kniffe und wurde größtenteils erduldet wie eine Wespe, der man nur deshalb nichts tut, weil die nächste sowieso kommt.
Am Tag meines offiziellen Arbeitsantritts erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben, was es heißt irgendwo nicht willkommen zu sein. Eine frostige Augenmauer beobachtete mich auf Schritt und Tritt, nur das Nötigste wurde mir geantwortet, ich kam mir vor wie ein Bräutigam, der einer Braut von den Eltern vorgeschrieben wurde. Der alte Oppenheimer stellte mich immer wieder alteingesessenen Gästen vor, zeigte mir hier und dort eine von mir noch nicht entdeckte Ecke und wies mich eindringlich darauf hin, daß die Toiletten die Visitenkarte eines Restaurants sind, so sagte er, die Visitenkarte, und ich sollte darauf achten, daß diese Visitenkarte blitzte.
Achmed, der kleine arabische Pizzeriolo, der den Pizzastraßenverkauf meisterte, war der erste, der mir einen Spalt Atmosphäre öffnete, und durch diesen Spalt kamen einzelne positive Signale von anderen Mitarbeitern.
Am Nachmittag, als wenig zu tun war, versammelte ich die diensthabenden Mitarbeiter an der Bar, fragte sie nach ihren Bedenken und wies sie darauf hin, daß ich für jede Kritik offen bin, für jede offene konstruktive Auseinandersetzung, Dschungelkrieg und Boykott aber keine Sekunde hinnehmen werde.
Der erste Tag verlief glimpflich ohne größere Blamagen, in den Pausen übernahm ich einmal die Bar und ein anderes Mal den Pizzaverkauf, ich fädelte mich vorsichtig ein und gewann Überblick und beobachtete ebenso genau wie ich beobachtet wurde.
Um ein Uhr nachts verabschiedete sich das Personal, die Kellner übergaben mir die Kassenschlüssel und die Tagesbons. Ich leerte fünf Kassen in fünf verschiedene Plastiktüten, schloß die Kassen ab und das große Café Pinguin; die schlimmste Nacht meines Lebens stand mir bevor. In meinem Untermietszimmer angekommen leerte ich alle fünf Tüten auf dem Bett aus, sah mir das viele Papier- und Münzengeld, die Schecks und Dollars an und hatte keine Vorstellung, was ich wie und wohin zuordnen mußte. Meine Schwester, die gerade zu Besuch in Israel war und in der gleichen Pension ein Zimmer bewohnte, wunderte sich nicht, als ich sie um zwei Uhr morgens weckte, sie in mein Zimmer bat, auf das Bett zeigte und: Mach mal, aber mach so, daß ich es verstehe, sagte. Sie schüttelte lachend ihren verschlafenen Kopf, setzte sich an die Bettkante, sah sich flink die Bons an, ordnete jedem eine bestimmte Geldsumme zu, murmelte zwischendurch, ist doch ganz logisch und war in ihrem Element. Gleichzeitig lief ich hin und her und sagte fortwährend, ich schaff das nie, nie....
In der Morgendämmerung habe ich die Abrechnung leidlich begriffen, meine Schwester ging angestrengt von einem weiteren Versuch in ihrem Leben, mir das Rechnen beizubringen schlafen und ich startete in den zweiten Tag der Geschäftsführung des großen Cafehauses.
An einem Tag, an dem ich den Dienst an der Bar übernommen hatte, so hieß der Tresen, von dem aus die Eisportionen für die Kellner, aber auch für die Straßenkunden bereitet wurde, -ich mußte schnell und kreativ bunte Eiskugeln in Glas und Metallschwenker drapieren, Espressos rausgeben, auch schon mal eine Suppe-, geschah es mitten im Schwung, daß kein Geschirr mehr da war, kein Eisbecher aus Glas, keiner aus Metall, keine Tasse, keine Untertasse, nichts. Als ich in die Küche kam, stand der junge Mann, der für das Geschirr zuständig war, grinsend da und rauchte eine Zigarette. Dany, sagte ich zu ihm, kein Dschungelkrieg, warum habe ich kein sauberes Geschirr an der Bar, was soll das?
In der hebräischen Sprache gibt es das distanzierte "Sie" in der Ansprache nicht, alle sprechen sich mit "Du" an, eine Distanz oder Formalität wird höchstens durch den Titel "Frau", "Herr", "Doktor" hergestellt.
Dany sah finster auf den Boden und antwortete: Ich bin nicht Dein Diener. Nein, sagte ich, Du bist nicht mein Diener, aber Deine Aufgabe ist es, für sauberes Geschirr und reibungslosen Nachschub zu sorgen. In dem Moment dachte ich noch, daß ich ihm mit Vernunft beikommen könnte, ich ahnte nicht, wie indiskutabel für ihn eine Frau als Chefin war. Er drückte seine Zigarette in einem herumsthenden Teller aus, sagte, ist mir egal, und legte seine nasse Plastikschürze ab. Gut, Dany, wenn Du in der Küche nicht arbeiten willst, dann bring im Gartenlokal hinten die Tische in Ordnung, ich lasse Dich abwechseln. Du hast mich nicht verstanden, sagte er verkniffen, ich bin nicht Dein Diener. Gut, Dany, wenn Du heute nicht arbeiten willst, stempel Deine Karte ab und nimm Dir einen Tag frei, bot ich erneut an, er: ich denke gar nicht dran. Ein Teil des Personals sammelte sich inzwischen um uns, neugierig darauf, was ich, die Neue, nun tun würde. Da der Betrieb weiterlaufen mußte, setzte ich einen anderen Mitarbeiter in der Geschirrküche ein und sagte Dany kurz, daß sein Arbeitstag für heute beendet sei. Zwei Stunden später kam der Junge Mann sauber gekleidet wieder ins Café, stellte sich an die Bar und bestellte provokativ eine Coca Cola. Nein, Dany, sagte ich bestimmt, wir haben keine Zeit für kleine Kriegsspielchen, keiner serviert Dir eine Coca Cola, laß Deine Kollegen arbeiten und komm morgen vernünftig wieder zur Arbeit. Dany nahm eine bedrohliche Haltung an und sagte, zu den Gästen gerichtet, eigentlich trug er eher vor: Du wirst heute Abend die Einnahmen nicht ungeschoren zur Bank bringen können, außerdem werde ich Deinen Gästen gleich ins Essen kotzen.
Wenn es irgend etwas gibt, was all meine Sinne weckt, so ist es eine möglichst unflätige Kriegserklärung seitens eines Mannes, oder eines Wesens, das sich für einen Mann hält. Gut, Dany, sagte ich ruhig, die Gäste und das Personal hörten und sahen gespannt zu, gut, Dany, Du willst mich bedrohen, zweimal darfst Du noch, weil alle guten Dinge drei sind, bei der dritten Drohung fliegst Du hier raus. Ich werde, höhnte er in meine Richtung, den Laden kurz und klein schlagen; zwei, sagte ich kalt. Dany bewegte sich nun cowboyartig zu einem alten Gast, beugte sich an sein Ohr und fragte ihn mit dem Zeigefinger auf mich weisend 'von dieser Hure willst Du Dich bedienen lassen?' Nun wars genug, ich ging ins Büro, rief die Polizei an und bat um Hilfe.
Während ich auf die Polizei wartete, gingen mir die Umgangsformen, die ich aus Deutschland kannte, durch den Kopf, ich hatte geradezu Sehnsucht nach der Distanz per Sie, nach den klaren Rollen und Höflichkeiten, hatte überhaupt keine Lust auf die hier anstehende Kraftmeierei.
Der kleine, ca 50jährige Polizist, der mein kleines Büro betrat, kannte Dany, er wohnte in seiner Nachbarschaft, leise sagte er zu mir: Laß ihn gehen, mach keine Anzeige, der ist unberechenbar... Ich konnte nicht zurück, weder dem Personal noch den Gästen gegenüber wollte ich einen Rückzieher machen. Sag ihm, sagte ich dem Polizisten, daß er ab sofort Lokalverbot bis auf weiteres hat.
Die erste Kraftprobe war bestanden, jeder kehrte zu seinem Arbeitsplatz zurück, Dany verließ mit dem Polizisten das Café und ich ging bis zum Schichtwechsel an diesem Tag in die Geschirrküche und lernte Danys Arbeit von der Pieke auf...
Die Gäste gewöhnten sich langsam an mich, insbesondere die Gruppe alter ungarischer Emigranten, vier Frauen und fünf Männer, die sich jeden Morgen im Café Pinguin einfanden, an einem runden, schattigem Tisch, einen Korb Weißbrot bestellten, und für jeden ein Glas Tee; dabei saßen sie dann, Tag für Tag, mindestens von 9.00 Uhr morgens bis 12.00 mittags, und sprachen miteinander diese langgezogene ungarische Sprache, die nur noch dem Finnischen ähnelt, und ärgerten täglich aufs neue die diensthabenden Kellner, weil sie einen Platz lange besetzten, ohne einen brauchbaren Umsatz zu machen, und doch schon durch ihr mumienhaftes Aussehen den gebotenen Respekt erzwangen.
Bis auf aufflackernde Sabotageversuche schien auch die Pinguinmannschaft mich langsam zu integrieren, wobei solche Dinge meinem Ansehen Aufschwung verliehen wie die Tatsache, daß ich sehr gerne Fische putze, entschuppe und von ihren Eingeweiden reinige - eine Sache, die mehr mit Arbeit als mit Repräsentieren zu tun hat.
Der Lächerlichkeit habe ich mich wohl nur einmal ernsthaft preisgegeben, unvermeidlich, und nichts und niemand hätte mir das ersparen können. An einem schönen Tag kam ein vierschrötiger, ca. 60jähriger Mann auf mich zu, ein vorstehendes Kinn und eine protzige Golduhr schmückten sein Erscheinungsbild.
Er kam auf mich direkt mit den Worten zu, Du siehst aus, als ob Du hier der Chef bist, ja, sagte ich fragend, ja , sagte er, kennst Du mich nicht? Nein, antwortete ich, einer der Kellner lief lächelnd vorbei, ich zuckte mit den Schultern und fragte diesen Mann, muß ich Dich kennen, ja, sagte er lachend, vom Kino? fragte ich, nein, sagte er, aus dem Fernsehen? bemühte ich mich, vielleicht, sagte er . Einige Gäste lachten zu uns herüber, nein, sagte ich zu dem Mann, ich habe keine Ahnung, na, Spiegler, sagte er, ich bin Spiegler. Es war mir peinlich, ich zuckte noch einmal mit den Schultern und sagte leise, ehrlich, keine Ahnung. Fußball? bot er fragend an, nichts, sagte ich erleichtert lachend, ich, Fußball, nichts. Gut, sagte er herzlich, reichte mir seine große Hand, ich bin Spiegler, der Trainer der israelischen Fußballnationalmannschaft. Die Gäste klatschten vergnügt in die Hände und einer der Kellner sagte mir im Vorbeigehen, ich glaube Du bist die einzige in diesem ganzen Land, die nicht weiß, wer Spiegler ist.
Der alte Ernst Oppenheimer kam jeden Tag in sein Cafehaus, er konnte es nicht lassen, Anweisungen zu geben, die egal wie unsinnig sie waren, ausgeführt wurden und nicht selten enstand ein Schaden, der nicht korrigierbar war. So zum Beispiel, als er dem kleinen Achmed, der für den Pizzaverkauf zuständig war, befahl, Pizzateig für 200 Portionen zuzubereiten; der Junge tat wie ihm befohlen mit der Folge, daß der größte Teil des Teigs, der nicht mehr aufgehoben werden konnte, weggeworfen werden mußte. Ernst, sagte ich ihm, Du hast mich doch angestellt, damit ich mich um die Dinge kümmere, nein, sagte er schieflächelnd, ich habe Dich angestellt, um etwas Hübsches im Cafehaus zu haben. Noch ein Macho, also, wenn auch ein alter, dachte ich und spürte, daß ich böse und beleidigt war. Als hohles Faß hat er mich hier haben wollen, als attraktive Puppe, eine zusätzliche Front war eröffnet.
Ernst, sagte ich, ich kann sofort aufhören, wenn Du hier weitermachen willst, ich bin zum Arbeiten hergekommen und nicht als Dekoration. Gutgutgut, sagte er erfreut darüber, daß er mich ärgern konnte, ich werde jetzt nur noch einmal täglich am frühen Nachmittag kommen und die Gäste fragen, ob sie zufrieden sind. Das tat er von nun an auch, mit dem Zusatz allerdings, daß, wenn ein Gast sich auf seine Nachfrage zufrieden über das Essen und die Bedienung äußerte, der alte Ernst Oppenheimer sich vorbeugte und flüsternd sagte, das kann doch nicht sein, es kann nicht alles in Ordnung sein, mir kannst Du es anvertrauen...
Da gab es noch in dieser schönen kleinen Stadt am Meer die Familie Biton; eine große Familie marokkanischer Juden, die das Café Pinguin jeden Schabbat beehrte. Über diese Familie flüsterten die orientalischen Bewohner der Stadt, Mutter Biton, die das Zepter über die Familie in der Hand hielt, Mutter Biton habe 21 Kinder und einen Hund geboren. Dieser Behauptung begegnete ich zum ersten Mal, als ich mit dem Trick der Familie konfrontiert wurde, die von mindestens 7 Familienmitgliedern eingenommene Mahlzeit deshalb nicht bezahlen zu wollen, weil angeblich ein Stein, ein Streicholzkopf oder sonst ein Stück Dreck im Essen war. An zwei Schabbats hatte ich ihnen die Bezahlung erlassen, beim dritten Mal wußte ich aber, daß sie selbst jedesmal ein Stück Etwas in das Essen taten, eben um nicht zu bezahlen. Als ich diesmal an den Tisch gerufen wurde, sagte ich ruhig, nee Leute, Ihr und ich wissen genau was hier gespielt wird, zweimal ist genug, diesmal bezahlt Ihr das Essen. Charly Biton, so wurde er in der Unterwelt genannt, Charly stand auf und hatte, ehe ich es mich versah, eine leere Flasche in der Hand, die er in Richtung meines Kopfes schwang und, Dich hat Hitler vergessen, brüllte. Ich ging ins Büro und rief in der Polizeistation an: Hier ist die Miriam vom Café Pinguin, Charly Biton macht uns Schwierigkeiten, schickt bitte jemanden vorbei, der ihn abholen soll; den Satz kaum zu Ende gesprochen, antwortete mir der Polizist, nee, Mädel, Biton, wenn Du mit ihm Schwierigkeiten hast, ruf seine Mutter an, und legte auf. Chaim, das Faktotum, kam gerade in mein Büro, er wußte, worum es geht, er setzte sich zu mir, vollkommen ernst, und sagte, laß die Bitons, das ist schon seit Jahren so, die Mutter hat 21 Kinder und einen Hund geboren, ich lachte, Chaim, was sagst Du da, doch doch, er sah mich ernst an, 21 Kinder und einen Hund, wiederholte er, Chaim!, Miriam, sagte er, ob Du es glaubst oder nicht, es ist so, und wenn Du es nicht glaubst, so nimm es für eine Beschreibung des Bösen, in Ordnung, und laß Dich mit dieser Familie nicht ein. Er verließ mein Büro und ich fing an zu begreifen, daß ich sehr weit von Europa und von Deutschland bin, nichts mit bekannten Spielregeln, nichts mit Höflichkeit, nichts mit Logik.
Nachts, wenn ich allein in meinem kleinen Zimmer war, überlegte ich mir, warum ich diesen Arbeitsmarathon angenommen habe, was ich eigentlich beweisen wollte und wozu. Klar war mir, daß die Eroberung eines unbekannten Arbeitsgebiets für mich ein Lebenselixier ist, eine spannende Herausforderung. Aber diese Arbeit war unendlich anstrengend und forderte unaufhörliche Präsenz.
Ich war schon ein Jahr im Pinguinbetrieb und die Arbeit lief reibungslos, ich hatte das Privileg, die Geheimnummer des Aufenthaltsorts der Kellner während ihrer Freizeit zu haben, eines Ortes, an dem sie täglich ihre Einnahmen verpokerten, sie hatten mir die Telefonnummer gegeben, damit ich sie, wenn nötig, herbeirufen konnte.
An dem Tag, an dem meine Handtasche aus meinem Büro gestohlen wurde, dachte ich, jemand von den Kellnern oder Mitarbeitern erlaubt sich einen Scherz.. Fast freundschaftlich bat ich jeden von ihnen, den Unsinn zu lassen und die Tasche wieder an ihren Platz zu tun. Bald stellte sich anhand ihrer ernsten Reaktionen heraus, daß die Tasche wirklich gestohlen war und niemand sich einen Scherz erlaubte. Diese Handtasche enthielt meine gesamten Identitätspapiere, meinen deutschen Paß, meinen deutschen Personalausweis, meinen israelischen Personalausweis, Presseausweise, Scheckkarten, alles. Ich hatte keinen Anhaltspunkt und keine Vorstellung, wer ein Interesse daran haben konnte. Achmed, der Pizzajunge, gab mir am Abend einen vorsichtigen Hinweis. Gut, sagte ich ihm, laß die Leute, die Du als Diebe vermutest, wissen, daß ich erst morgen zur Polizei gehe, bis dahin können sie mir die Tasche wieder zurückgeben.
Gleich am Morgen des nächsten Tages, noch während ich die Tür zum Cafehaus aufschloß, klingelte das Telefon, die Stimme eines jungen Mann sagte, Du kannst den Inhalt Deiner Tasche wiederhaben, einzeln, und für jedes Stück wirst Du einen Betrag bezahlen, ansonsten will ich Dir noch sagen, daß mich die Polizei nicht schreckt, ich habe mit ihr schon oft zu tun gehabt, bin auf der Polizeistation auch schon geschlagen worden, es schreckt mich nicht, und legte auf. Charly Biton schoß es mir durch den Kopf, ich kam mir schäbig vor, noch einmal zur Polizei, gab es keinen anderen Weg?
Nachmittags, als der alte Oppenheimer seine Visite im Cafehaus abhielt, sprang ich in ein Taxi und fuhr zum Polizeirevier, schilderte dort das Geschehene und sagte, Achmed, der kleine Pizzeriolo, könne alles bezeugen. Gut sagte der Polizist, ich bringe Dich ins Pinguin zurück und vernehme den Achmed dann gleich. Sie setzten sich in mein kleines Büro und sprachen eine Weile miteinander, dann kam der Polizist achselzuckend heraus und sagte zu mir: Achmed hat nichts gesehen, er kann nichts bezeugen, stieg in das Polizeifahrzeug und fuhr davon. Achmed, sagte ich, was ist passiert? Nichts, sagte er verschlossen, ich habe nichts gesehen, ich weiß nichts.
Da ich zu Hause abends meinen israelischen Paß gefunden hatte, wußte ich, daß ich trotz des Diebstahls nicht festgenagelt war. Ich wollte in Ruhe herausfinden, was Achmeds Meinung so verändert hat. Die Lösung wurde mir abends telefonisch vom alten Oppenheimer mitgeteilt: Wir, sagte streng, lassen uns mit den Bitons nicht ein, wir wollen keinen Krieg, wir lassen die Sache auf sich beruhen. Wieder schoß es mir durch den Kopf, keine Spielregeln, nichts Logisches, nichts Bekanntes. Noch zwei Tage hielt ich es im Café Pinguin aus, ich fühlte mich während der zwei Tage nicht nur bestohlen, sondern auch belogen und betrogen. Am Mittag des zweiten Tages nach dem Diebstahl sagte ich dem alten Oppenheimer, ich gehe jetzt, ich kann so nicht weiterarbeiten, und ich ging.
Einen Monat später, zwei Tage vor meiner Rückkehr nach Deutschland, ging ich noch einmal als Gast mit einem Freund ins Café Pinguin. David, der dicke Kellner mit dem verschlagenen Blick im Babygesicht, war für meinen Tisch zuständig, er begrüßte mich herzlich, setzte sich einen Moment zu uns und sagte: Hör mal, im Arabischen gibt es einen Spruch der heißt: Fi Mara, fi Marmara, fi Musmar fil untara und das heißt: Es gibt eine Frau, es gibt eine bittere Frau und es gibt eine Frau, die wie ein Nagel im Nacken ist, verstehst Du? Du warst uns ein Nagel im Nacken, ich bin sicher, Du hast viel von uns gelernt, wir aber auch von Dir, und solange ich hier arbeiten werde, geht Dein Kaffee auf meine Rechnung.
Also war ich doch kein Verlierer, dachte ich, auch kein Gewinner, wir sind einfach ein Stück Weg zusammen gegangen. Meine Mutter, Gott hab sie selig, sagte: elefantös.