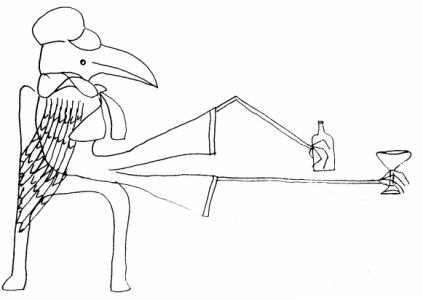
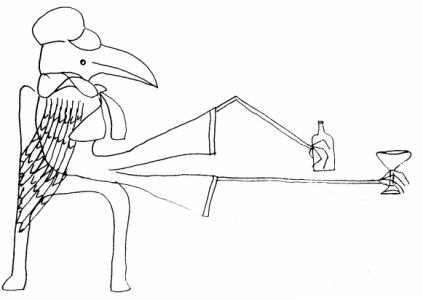
vier-Männer Dokument
Meine vier Wegweiser
Neulich, als ich über die von Autos erstickte Straße vor meiner Haustür ging, versuchte ein kleiner alter Mann, den Kopf in einem verwitterten Hut versteckt und die Schultern eingezogen, über den Zebrastreifen mit viel zu kurzer Ampelschaltung zu gehen. Ich fragte ihn, ob ich ihm helfen könne, nein, danke, sagte er bestimmt und schmunzelnd, lassen Sie mich das mal alleine machen. Er denkt gar nicht dran, ging es mir durch den Kopf, er denkt gar nicht dran, sich in eine Alterskrüppelrolle drängen zu lassen. Ich hatte fast das Gefühl, mich für meine Zudringlichkeit entschuldigen zu müssen, tat es aber nicht, weil mir die drei für mich wichtigsten alten Männer einfielen, Männer, ohne deren Freundschaft, ich mir die letzten zwanzig Jahre meines Lebens nicht vorstellen möchte . Jeden dieser drei Männer lernte ich erst kennen, als sie nach gängigem Sprachgebrauch schon alt waren. Ünd jedem dieser drei Männer bin ich für ihre kluge Freundschaft dankbar. Alle drei haben mich gelehrt, hinter ihrer "alten Fassade" nichts Verbrauchtes, zu Ende Gehendes zu sehen, sondern volles und mutig gelebtes Leben, ohne Selbstverleugnung und ohne Eitelkeit. Sie sind, jeder in seiner Weise und Eigenart, Brücken von der Vergangenheit in meine Gegenwart, Muster für Erlittenes Ertragenes, und Gemeistertes, sie sind Menschen, die ich liebe.
Der Casanova von Jerusalem
Seine Gepflegtheit gleicht aufs Haar der in englischen Filmen dargestellten Gentlemen, die blond, sportlich, distanziert und zugleich bestimmt sind.
Heute im Alter versorgt er die Menschen in seiner Ümgebung mit seiner Kraft, einer Kraft, die er, wie er sagt, aus der Tatsache schöpft, daß Hitler es nicht geschafft hat... Aus der Tatsache, daß wir trotz allem ein eigenes Land haben, und so wunderbare Kinder, die hier aufwachsen, nicht sorglos, wo hast Du schon mal sorglose Juden gesehen?. Aber im eigenen Land aus 70 Nationen der Welt mit einer richtig schönen eigenen Muttersprache und eigener Musik und nicht zu Gast bei wetterwendischen Völkern.
Alec war der Geliebte meiner Mutter, Gott hab' sie selig. "Er war ein Gentleman, ein feinfühliger Liebhaber" sagte sie mir einmal.
Alec , der heute als Pensionär des Jerusalem Rundfunkorchesters in Jerusalem lebt und als Heilpraktiker unentbehrlich ist, begann seine Musikerlaufbahn in Polen.
Als Jugendlicher begleitete er mit der Geige die Stummfilmvorführungen in den ersten Kinos in Warschau, später spielte er dann in Bars und Nachtlokalen und lernte so die halbseidene Ünterwelt und die sich dort amüsierende Oberwelt kennen, von der Pieke auf.
In seiner schönen alten Wohnung in Jerusalem steht ein Klavier, genauer ein Piano, das alljährlich für viel Geld von einem russischen Einwanderer gestimmt wird. Keiner spielt auf diesem Piano; Alec wird es nach seinem Tod der Stadt Jerusalem vermachen, deshalb hält er es im Klang.
Er ist ein mittelgroßer, kräftig gebauter sechsundsiebzigjähriger Mann, zuckerkrank, morgens und abends muß er seinen Körper mit Insulin malträtieren, darauf achten, daß seine Augen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, strengste Diät einhalten.
Auf seinem mattblonden Kopf ist nicht ein weißes Haar. Seine groben Hände sind verkrüppelt, sehen aus wie im Dauerkrampf, die Finger starr, halbgebogen, als wären die Sehnen verkürzt.
Musik kann Alec, der zuerst Geiger und dann Schlagzeuger war, nicht mehr machen; er vermißt die Musik auch nicht.
Als er in Pension ging, beschloß er, keine Musik mehr zu hören; in seiner Wohnung gibt es kein Radio und keinen Plattenspieler. "Versteh das bitte", sagt er, "ich habe mit allen Größen der Musik gespielt, ich wüßte immer, wo ein falsches Tempo, ein falscher Ton, eine falsche Interpretation ist, ich könnte es nicht ertragen". Alec hat eine berstende Geduld mit seinen Patienten, seinen Nachbarn, seine Freunden. Er schaukelt ein ganz klein wenig mit seinem Oberkörper nach rechts und links, während er zuhört, kraftvoll und aufmerksam.
Er hat nie geheiratet. Er hat immer gehofft, daß noch von irgendwoher jemand aus seiner Familie auftauchen würde, der an einem solchen Fest teilnehmen könnte. Seine Eltern und seine Schwester sind im Warschauer Ghetto von den Nazis umgebracht worden. Wenn er das sagt, weil es so ist, zieht er die Schultern ein wenig hoch, nur ein wenig, als wollte er sagen: Ich glaubs bis heute nicht.
In seiner Jugend nannte man ihn den Casanova von Jerusalem. Er ist ein Künstler, ein Musiker mit einer zertrümmerten Kultur, ein ganzer Mensch, wie man auf Jiddisch sagt.
Als er, er muß um die 16 Jahre alt gewesen sein, nach Hause kam und nur ein Stück trockenes Brot auf dem Küchentisch sah, wußte er, daß er seine Eltern nicht mehr sehen würde, er sieht mich an, zieht die Schultern wieder ein wenig hoch und sagt - ich wußte es.-
Manchmal sagt er so etwas wie "die Deutschen sind Befehlsempfänger, befiehlt man ihnen Juden zu töten, töten sie Juden.
Befiehlt man ihnen demokratisch zu sein, sind sie demokratisch, nu ja, ich war mein Leben lang Sexualdemokrat," - und er lächelt verlegen.
"Keine der Frauen in meinem Leben", sagt er, "hat je gewußt, wie einfach ich zu haben bin, sie haben den Punkt nicht verstanden, den Punkt, an dem ihre Nähe mich die Nähe meiner Familie vermissen ließ, und ich konnte es nicht artikulieren, weil der Schlund meiner Einsamkeit mich selbst schreckte. So tranken wir Whisky, ergingen uns in Attitüden, besuchten Lokalitäten und wirkten strahlend im Nachtleben der Stadt Jerusalem vor der Staatsgründung.
Ünd dabei wollte ich meinen Vater, meine Mutter und vor allem meine Schwester wiedersehen, nur für einen Moment, nur auf ein Wort..."
Er ist eine große, knorrige Brust, an die ich meinen Kopf lehne, wenn wir allein sind, alle Freunde und Patienten gegangen sind.
Ich brauche ihn, dieses Monument an Menschlichkeit, seine Härte und Weichheit und diesen fragenden Blick, wenn alles unklar ist zwischen uns, er mir Kraft gibt, ich ihm, wie zwei Kinder auf einer Wippe.
Zweimal in der Woche geht er ins nahegelegene Krankenhaus, ihm von den Ärzten zugeteilte frischoperierte Patienten besuchen. Dort darf, ja soll er seine Zauberkraft ausspielen. Er setzt sich breit in den Besucherstuhl im Krankenzimmer, dem erschöpften und besorgten Patienten gegenüber, legt seinen Kopf schräg in die Schulter und fragt "nu?, was tut sich?" und wartet geduldig auf den staunenden Kranken, der ihn nicht kennt.
Er wartet auf eine Regung, eine Antwort, ein Stöhnen, Schluchzen oder Lächeln, dann kann er die Lage besser einschätzen, sagt er. Die ganze Zeit in respektvoller Haltung, einfach nur anwesend und ruhig. Wie schwer auch immer die Operation war, Alec setzt am Punkt des Lebenswillens an, beruhigt die Seele, ermutigt, gibt Selbstvertrauen und beginnt mit kleinen, ganz kleinen fast witzigen &Üuml;bungen wie "krimmen wir mal den kleinen Finger, weil das gibt dem Herzen Kraft".
Dann hört er wieder zu, wenn es traurig ist, seinen Kopf hin und her bewegend, "oi, oi" sagend und wenn es zuversichtlich ist, bescheiden lächelnd. Er verabredet den nächsten Besuch, ohne zu vergessen, noch ein paar Erledigungen in Auftrag zu nehmen und geht.
Nebenher korrigiert Alec die Haltung von Musikern, das heißt, daß Musiker jeden Alters und aller Couleur zu ihm kommen, um mit ihm Entspannungsübungen für ihre durch das Instrumentenspiel einseitig belasteten Muskeln zu erarbeiten.
Dabei kann es passieren, daß er einem Schlagzeuger zur Beendigung seiner Arbeit am Schlagzeug rät, mit einem Dirigenten Yogaübungen macht und mit einer Cellistin Atemgymnastik.
Ganz beiläufig bespricht er mit den Musikern ihre Schlaf- und Eßgewohnheiten, rät zu Ruhe und Bewegung, macht vorsichtig Vorschläge, gibt zu bedenken.
Eltern kommen mit musizierwilligen Kindern zu ihm, ihn zu befragen, ob die Instrumentenwahl ihres Kindes die richtige ist, dann stehen Koordinationsprüfungen an, so wie er sie schon bei mir gemacht hat, dreh Deinen linken Fuß kreisend nach innen und Deine flache Hand auf Deinem Kopf in die entgegengesetzte Richtung und die andere Hand auf den Bauch, und ich stehe vor ihm, staunend darüber, daß ich einen Fuß, eine Hand, einen Kopf, noch eine Hand und einen Bauch habe...
Er lacht, nach einem arbeitsintensiven Tag und dann, abends, sagt er, werden wir beide es uns gemütlich machen.
Abends sitzen wir dann in seinem schönen Wohnzimmer, dem Fernseher gegenüber, auf dem Tisch ein Tablett voller Datteln, Nüsse und Mandeln, zwei einsame Verbündete, froh über diesen Tag, der uns nichts Böses getan hat. Vor dem Schlafengehen setzt er sich noch einmal die obligate Insulinspritze und freut sich so auf den nächsten Tag, daß ich Zweifel in seinem Gesicht suche.
Denk dran, sagt er, wenn Du morgen aufstehst und Dir nichts wehtut, ist es ein Zeichen, daß Du tot bist.
Benjamin ist am 3.Februar 1992 gestorben. Ein guter Freund sagte mir einmal, wenn Erinnerungen Nahrung für die Toten sind, müssen meine Toten gut genährt sein.
Der Mann ohne Rachegefühle
Benjamin ist ein hagerer, etwas gebeugter alter Mann, den ich in einem Cafehaus in Nahariya kennenlernte, weil er seine Neugierde nicht zähmen konnte.
Damals, vor 17 Jahren in Israel, kam er auf mich zu, ich muß es wissen, sagte er, ich höre Du bist in Deutschland verheiratet, hast dort einen Sohn, wie kommt es dann, daß Du hier lebst...
Er war 70 Jahre alt, als wir uns kennenlernten, leitete Servas in Israel, Teil einer internationalen Gastfreundschaftsorganisation mit Sitz in der Schweiz, der in mehr als 70 Staaten der Welt Gastgeberfamilien angeschlossen sind, die bereit sind, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religion bei sich für ein paar Tage aufzunehmen und vice versa bei Servas-Freunden einzukehren.
In den Leitlinien heißt es u.a."Niemand erwartet eine komfortable Ünterkunft", es geht darum, durch persönliche Bekanntschaften, Ünkenntnis und Vorurteile abzubauen.
Benjamin begleitete deutsche Reisegruppen durch Israel, leitete arabisch-jüdische Jugendgruppen und führte sie ins Ausland, probierte das Barfuß-über-glühende-Kohle-laufen aus, war im Ashram in Poona, tyrannisierte seine Frau Hannah mit ständig angeschleppten Gästen und legte sich mit jedem Israeli an, der nichts von Deutschland und den Deutschen wissen wollte. Ebenso wie mit Israelis, die noch nicht einmal eine Bekanntschaft mit Arabern versuchen wollten.
Benjamin ist gebürtiger Berliner. Er verließ Deutschland schon 1931, nachdem seine erste Arbeitsstelle als Gartenarchitekt von einem reichen Darm- und Fellhändler auf Rügen wegen seiner mosaischen Glaubenszugehörigkeit gekündigt wurde.
Seine Mutter, die nach dem Tod seines Vaters allein für ihn und seine drei Geschwister aufkam, sah seiner Absicht, nach Palästina zu gehen mit Angst entgegen: Ich habe Dich nicht geboren, damit die Araber Dich umbringen, hielt sie ihm immer wieder vor und tat ihr Bestes, seine Reise zu verhindern.
Er lebte anfangs in einem der ersten Kibbuzim Israels und brachte seine in Deutschland erlernten landwirtschaftlichen Kenntnisse ein.
Später wurde er landwirtschaftlicher Berater und Mitbegründer der nordisraelischen Stadt Nahariya, einer von Deutschen Emigranten gegründete Stadt am Meer, von der man sich erzählt, daß jeder, der damals an diesem Ort vorbeikam, ein seltsames Gemurmel hörte. Näher herangekommen stellte man dann fest, daß die Jeckes, aus Deutschland geflohene Doktoren und Professoren, während sie sich die Steine reichten, fortlaufend "Dankeschön Herr Doktor, bitteschön Herr Doktor" sagten.
Während des Aufbaus der Stadt werden nämlich an jeder Ecke Steine weitergereicht ; so ist dieses Naturhörspiel leicht erklärt.
Benjamin ist überhaupt kein freundlicher, netter alter Mann, er ist eher nervös, immer aktiv, sehr klar in seinen Vorstellungen von Mitmenschlichkeit. In seiner Ümgebung findet er nicht nur Anerkennung, sondern auch Anfeindungen. Der Spinner, der Idealist, sagen manche Leute, die nichts von Verständigung und Versöhnung wissen wollen.
In den arabischen Dörfern des Galiläa ist er mit seinen deutschen und israelischen Gästen ein gern gesehener Gast.
1948, nach der Gründung des Staates Israel, hat er durch rechtzeitige Absprache mit arabischen Dorfbewohnern erreichen können, daß diese nicht vor der israelischen Hagana, der vormilitärischen Bürgerwehr, fliehen mußten.
Er besuchte die Araber in ihren Dörfern, klärte sie auf und beschwor sie, weder zu fliehen noch zu kämpfen. Ihre Flucht hätte eine Flucht ohne Wiederkehr bedeutet und Widerstand wäre ihr Tod gewesen. Hißt die weiße Flagge, dann wird Euch nichts geschehen, sagte er ihnen. Sie kannten Benjamin gut genug und wußten, daß sie ihm vertrauen konnten. Sie hißten die weiße Flaggen und konnten in ihren Dörfern bleiben, keinem wurde auch nur ein Haar gekrümmt.
Das haben Benjamins arabischen Freunde ihm zeitlebens nicht vergessen.
Ünsere erste und letzte ernste Auseinandersetzung haben wir im Jahr 1987, als Benjamin mir den Brief einer deutschen Behörde zeigt, die ihm auf Anfrage mitteilt, daß sein Bruder Ernst 1945 auf der Flucht aus dem KZ Birkenau, genauer gesagt auf dem Todesmarsch, erschossen worden ist. Es ist ein amtlicher Brief, formal und ohne jedes Sentiment. Benjamins Mutter wurde in Auschwitz ermordet.
Ünd Du, schreie ich ihn an, versöhnst Dich mit den Deutschen, predigst Frieden! Wo ist Deine Ehre, die Ehre Deiner ermordeten Familie? Benjamin sieht mich ruhig an, er schweigt lange, läßt mich wohl absichtlich mit meinem Gefühlsausbruch allein und sagt dann: Wohin soll das führen? Ich kann mit Haß nicht leben und ich will mit Haß nicht leben. Glaub' ja nicht, daß ich irgendwas verdrängt habe, aber ich bin sicher, daß meine Bemühungen, die Israelis mit Deutschen und mit Arabern zusammenzubringen schon Früchte getragen haben. Ein wenig Einblick in das Leben der Fremden baut Vorurteile ab.
Er gießt sich und mir Tee ein, setzt sich und fügt nachdenklich hinzu: Klar, wo ein Wald ist, sind auch Wölfe...
Wenn Du versuchen würdest, einen Blick für das Sehen zu haben, sagt er müde, fast stöhnend, wüßtest Du zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden und dann würdest Du, -er wirkt, wieder wach und energisch-, Deine Kritik für die Gegenwart und Zukunft nutzen, und nicht an die Vergangenheit vergeuden.
Das Erstaunliche an seinen Worten ist, daß es nicht nur Worte sind. Jedes seiner Worte deckt sich mit seinem Lebensinhalt: Brücken bauen. Nein, Benjamin ist nicht nett, er hat eher etwas Strenges, dickköpfig Diszipliniertes an sich. Aber alles, was er hinterlassen hat, Freundschaften zwischen Arabern und Israelis, Freundschaften zwischen Israelis und Deutschen, beweist, daß sein Weg nicht falsch war, daß seine Dickköpfigkeit eigentlich Kraft war.
Nein, in mir ist Benjamin nicht tot und schon gar nicht weg. Jedesmal, wenn in mir gnadenlose Wut und Bitterkeit gegen Ünmenschlichkeit und Gleichgültigkeit aufkommt, denke ich an ihn und sein Vermächtnis.
Jossele, der Faschist
Jossele ist mir abhanden gekommen, ich weiß nicht, ob er noch lebt und wenn ja, wo. Sein richtiger Name ist Josef Ausländer, die Leute nannten ihn aber Jossele, den Meschuggenen, ich nannte ihn Jossele, den Faschisten. Er muß um die 68 Jahre alt gewesen sein, als ich ihn in einem schönen, von älteren Menschen besuchten Schwimmbad am Meer in Tel Aviv kennenlernte. Sein Erscheinen, würde man heute sagen, war schrill. Er war laut, sprach Hebräisch, Jiddisch und Deutsch durcheinander, trug eine weiße Badehose, aus der sein fetter Körper herausquoll. Ein übergroßer goldener Davidsstern schmückte seine Brust, die rosarot war vom tapfer ertragenen Sonnenbrand.
Als wir einander vorgestellt wurden, sagte ich nur immer wieder: Sch, sch, Jossele, nicht so laut, ich verspreche, ich höre Dir auch zu, wenn Du nicht schreist, sch, Jossele, sch. Mäidele, sagte er, Mäidele, während er sich schweratmend neben mich hockte, ich wußte, Du würdest mich lieben, ich dachte nur nicht, daß es sofort passieren würde...
Bis zu diesem Moment, war mir nur seine Lautstärke und Körperfülle aufgefallen, nun sah ich ihn an, lachend, und begegnete zwei blauen Jungenaugen, die gleichzeitig verschmitzt und schüchtern waren. Er hat Angst, dachte ich, er ist wie ein lautes Kind im Dunkeln, seltsam...
Die Menschen, die die Morgenclique in dem Schwimmbad in Tel Aviv bildeten, sind israelische Senioren, die zum Erhalt ihrer Gesundheit jeden Morgen in das Schwimmbad kommen, sich über die politischen Ereignisse unterhalten, familiäre Neuigkeiten austauschen, manchmal heftig debattieren, einige spielen im Schatten Schach.
Es ist eine Gruppe Menschen, die sich seit Jahr und Tag trifft. Jeder kennt jeden, einige nennen sich Freunde, einige nennen sich Bekannte, eines haben sie gemeinsam, sie sind alle der Shoah entkommen.
Sie haben verschiedene Akzente, einer aus Üngarn, einer aus Polen, einer aus Russland, wieder ein paar aus Deutschland, Jossele ist aus der Bukowina, also Österreich, sagt er.
Immer, wenn die Morgengespräche politisch werden, wird Jossele zum Tier. Besonders wenn es um das Lebensrecht der Palästinenser in Israel geht.
Sie müssen raus aus dem Land, brüllt er dann, wir brauchen hier keine Terroristen, die Araber der Welt können sie aufnehmen und sich mit ihnen rumschlagen, ich bin hier der Herr, ich habe hier das Sagen, wer braucht sie überhaupt? Mir verschlägt es die Sprache. Jossele, sage ich böse, Du sprichst wie ein Faschist, ein Land für ein Volk undsoweiter, das Herrenmenschengebaren müßtest gerade Du irgendwoher kennen. Mäidele, sagt er mir, Du weißt nicht, was Du sagst, ich ein Faschist, ich kann keiner Fliege etwas zu Leide tun. Er schüttelt den Kopf, sieht auf den Boden und pustet noch einmal, ich, ein Faschist... Das Erstaunliche ist, daß keiner Jossele widerspricht, sie lassen seine Tiraden über sich ergehen und verhallen und ich weiß nicht warum.
Eines Tages lädt mich Jossele in ein kleines Cafehaus in der Stadt ein, wir wollen mal ernsthaft miteinander sprechen, sagt er lustig am Telefon.
Er trifft laut und unübersehbar in dem kleinen Straßencafe ein. Sein beleibter Körper ist in weiße Jeans gequetscht und mit einem engen weißen, die Brust freilassenden Hemd bekleidet, am Hals der übergroße, protzige goldene Davidsstern. Jossele macht es einem wirklich schwer, ihn nicht für meschugge zu halten. Er setzt sich fast hektisch auf meine Seite, streichelt freundlich über meinen Rücken und fängt an:
Du weißt nichts über mich, Mäidele, und Du weißt nicht, was das Leben mir zugemutet hat, ob Du gnädiger bist, wenn Du mir zugehört hast, weiß ich nicht, Mäidele, Du mußt es wissen.
Ich bin in der Bukowina aufgewachsen, mein Vater war ein wohlhabender Mann und uns fehlte nichts. Das hat sich mit dem Aufkommen der Nazis schlagartig geändert, es ging alles so schnell, unfaßbar.
Mein Vater, Gott hab' ihn selig, hat mich gezwungen, nach Palästina zu gehen, ich hatte mit diesem Teil der Erde nichts am Hut, ich hatte weder das Zeug zum Bauern noch das Zeug zum Soldaten.
Ich sehe mich heute noch, wie ich damals im Wehrdorf Wache hielt, mit dem Gewehr an der Schulter, ich kam mir absurd und verloren vor, was hatte ich mit diesem primitiven Malarialand zu tun?
Seine Augen sehen in die Ferne, er wischt sich den Schweiß vom nassen Gesicht und fährt fort. Dann haben sie meine Eltern, meinen Bruder und meine Schwester umgebracht, da hatte ich schon keine andere Wahl, mußte ich bleiben im Land. Seine Sätze gleiten ins Jiddisch. Dann habe ich kennengelernt meine Frau, ein nettes Mädchen, es war keine große Liebe, aber man mußte machen eine Mischpoche, nachdem sie alle umgebracht haben, die Nazis. Ünd dann hatten wir einen Jingele und ein Mäidele, ich konnte mir leisten, ein halbes Jahr in Düsseldorf zu leben und ein halbes Jahr hier im Lande, ich habe mit Antiquitäten gehandelt, das Geschäft ging ganz gut.
Meine Frau und die Kinder lebten hier in Tel Aviv, manchmal kamen sie mich besuchen, ich jedenfalls war ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr dort.
Ünd dann, am 30. Mai 1972, ich kam von Düsseldorf zurück, meine Frau und die Kinder, der Junge war 14, das Mädel war 12 Jahre alt, kamen mich vom Flughafen in Tel Aviv abholen. Es war so plötzlich, so kurz, so schlimm, Mäidele, hör mir zu, ein kleiner Mann, ein Japaner, schoß einfach um sich, wir hatten uns noch nicht einmal umarmt, noch nicht einmal begrüßt...
Er macht eine Pause, wischt sich den Schweiß vom roten Gesicht, den Rest weißt Du ja, sie war dabei, meine Frau, vor den Augen der Kinder erschossen, eine von 26 Toten und 77 Verletzten, Kozo Okomoto hieß der Japaner, aus der Presse kennst Du die Geschichte, oder?
Ich schweige, mir ist kalt in der Hitze. Das Land, sagt er, dieses Land ist mein Land, hier kann niemand auf mir herumtrampeln, hier bin ich nicht irgendwelcher Leute Judd, hier bin ich nicht zu Gast, und trotzdem ist es meinen Kindern und mir hier passiert.
Ich bin ein Jahr nicht aufgestanden vom Bett, ich bin ein Jahr nicht herois gegangen auf die Straß'. Hab ich gestritten mit Gott, ein Jahr lang, jeden Tag, ein Jahr lang, Gott und ich im Streit, warum ich, warum so viel, wie viel noch, ein Jahr, Gott und ich allein. Eine Melange, sagt er der jungen Kellnerin, eine Melange für Jossele.
Ich bin versteinert, wenn ich das erlebt hätte, ich kann es mir gar nicht vorstellen, deshalb haben die im Schwimmbad nichts gegen seine Tiraden gesagt, sie wissen um seine Geschichte.
Na, Mäidele, sagt Jossele, ich bin ein Faschist, sagst Du, nur weil ich schrei meinen Schmerz herois. Gott der Gerechte, hab' ich noch nie nischt keiner Fliege zu Leide getan, will ich nur nischt sein der Golem, immer der Golem.
Mein Mund ist versiegelt, ich kann zu nichts Normalem übergehen, finde keine &Üuml;berleitung zum Jetzt und Hier, ich lege meinen Kopf auf seine Schulter, will für seine Geschichte getröstet werden, kann nicht trösten, verstehe plötzlich seine immer weiße Kleidung, seine Ichhabedochniemandemetwasgetankleidung.
Was macht man, wenn das eigene Leben zweimal von einem Abgrund verschlungen wird? Wird man fanatisch? Wird man verrückt? Oder trägt man nur noch weiße Kleider und versucht, den Rest zu ertragen, indem man wie ein kleines Kind in der Dunkelheit schreit?
Wir gehen am Strand spazieren, Jossele fährt am nächsten Tag wieder nach Düsseldorf. Wir wollen uns in Deutschland wieder treffen, sagt er zum Abschied, ja, Mäidele?
Als er sich ein Jahr später bei mir in Berlin anmeldet, lasse ich mich verleugnen. Wir können unsere Leben nicht aneinander koppeln, ich will ihn nicht verletzen. Ich liebe Jossele so sehr, daß ich niemals an seinem Grab stehen möchte, ich bin feige, ich habe Angst und jetzt, Jahre danach, habe ich ihn aus den Augen verloren, ich weiß nicht, wo er lebt.
Der alte, stolze Mann, der über die Straße ging, hat sie mir alle wiedergebracht, die drei, die in den Augen anderer Menschen vielleicht nur alte Männer sind.