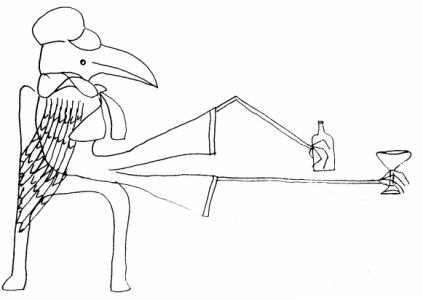
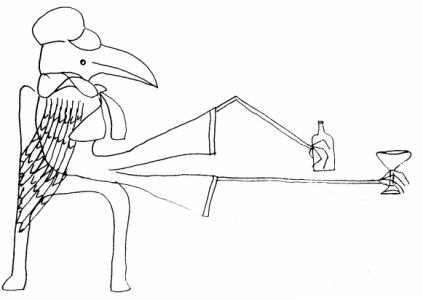
Das freche Ding ist aus den Augen verschwunden
Versuch über das Altern
Es gibt ein Thema, über das läßt sich mit den beiden Männern in meiner Familie nicht sprechen. Der eine Mann, es ist mein Mann, gerade mal 52 Jahre alt, der andere Mann, mein Sohn, ist 30 Jahre alt. Immer, wenn ich darauf zu sprechen komme, laufen sie entweder weg, richtig physisch, der eine muß gerade mal in die Küche gehen, sich einen Tee machen, dem anderen fällt etwas dringendes ein, das er sofort erledigen muß und bisher, just, vergessen hat. Es ist vollkommen egal, von welcher Seite ich das Pferd aufzäume, ob ich Norbert Blüm und seine Rentenpläne, Manfred Seehofer und seine Gesundheitspolitik oder einfach mein Bedürfnis, über Realitäten zu sprechen, zum Anlaß nehme, die Reaktion der beiden ist immer die gleiche.
So etwas hat es bei uns zu Hause noch nie gegeben, es gab keine Tabus, wir haben immer miteinander sprechen können, mal mehr und mal weniger engagiert, aber so gar nicht, das hat es nie gegeben.
Wann es genau begonnen hat, weiß ich nicht mehr, und es ist nicht selbstverständlich geworden, obwohl es schon seit Jahren da ist, wie vieles, was seit Jahren da ist, plötzlich Aufmerksamkeit verlangt, und keiner hat mich darauf vorbereitet.
Mein Freund David dagegen, er ist 60 Jahre alt und hat schon einige gesundheitliche Probleme und eine Bypassoperation hinter sich, reagiert erfreut, ja fast so, als hätte er längst darauf gewartet, auf das Thema angesprochen zu werden. Er meint, daß das mit dem Altern ganz gut eingerichtet ist. Für ihn beginnt das Altern mit ungefähr 50 Jahren (genau so alt bin ich jetzt), und es bedeutet, so sagt er, das Erlernen des Abschiednehmens. Ganz langsam, von der Kindheit, von der Jugend, von der Kraft, von der Gesundheit, von Kollegen und dann langsam von Freunden, die schon vor einem davongegangen sind.
Chana, meine fünfundachtzigjährige Freundin, lacht immer, wenn ich das Thema anschneide.
Chana ist eine schöne Frau, sie hat große, klare, blaue Augen, ein wie aus Holz geschnitztes Gesicht, aus schönem olivfarbenen Holz; ihre große Nase ist ein wenig gebogen, ihr Mund mitten in den vielen großen Falten, ihr kluger Mund.
Eine Prinz-Eisenherz-Frisur umrahmt ihr großes Gesicht und macht sie jung. Sie ist mit den Jahren klein geworden; sie hat auf der rechten Schulter einen Buckel. Seit ihrem vierzigsten Lebensjahr. Mit ihren großen zerfurchten Händen malt sie an einer Staffelei mit Ölfarben fast ausschließlich Blumenbilder. Sie hat unzählige Malkurse besucht und tut es immer wieder. Dennoch ist ihr Stil vom ersten Tag ihres Malens bis heute gleich geblieben. Und es gibt viel Blumen in der kleinen nordisraelischen Stadt, in der sie lebt, von Anemonen bis zu Iris, Alpenveilchen und Sonnenblumen alles, was man sich an bunten in Grün ruhenden kleinen Blumenwundern vorstellen kann. Sie hat zwei Töchter und einen Sohn, alle zwischen 55 und 60 Jahre alt, 9 Enkel und 6 Urenkel, sie ist seit dem Tod ihres Mannes vor vier Jahren die Matriarchin der Familie, und auch ich habe mich bei ihr eingenistet.
Als ich vor sieben Jahren an einem Schabbat einfach so bei ihr vorbeischaute, nachmittags zum Kaffeetrinken, sah sie mir ruhig und lange ins Gesicht, in die Augen, und sagte dann, "Es ist weg, es ist nicht mehr da".
"Was ist weg", fragte ich sie, und dachte eher an ein Muttermal oder eine Falte in meinem Gesicht. Sie sah mich ernst und ruhig an und sagte: "Deine Jugend, - dieses freche Ding in Deinen Augen". Meine verräterischen Augen, ärgerte ich mich und sagte, "Chana, das freche Ding, meine Jugend, wie Du es nennst, ist aus meinen Augen am Tag des Todes meiner Mutter verschwunden".
Wenn sie, meine alte Freundin, es schon beim Namen nennen kann, dachte ich, dann ist es manifestiert, sichtbar, ungefragt, präsent.
"Du weißt ja, an meinem fünfzigsten Geburtstag werde ich mir das Leben nehmen, also ist es egal". Chana lacht und sagt, "Glaub es mir Kind, ich habe mir geschworen, mit fünfzig aus dem Leben zu scheiden, auch ich konnte es mir nicht vorstellen, irgend etwas mit der Zeit nach dem Fünfzigsten anfangen zu können, und sieh mich an, ich sitze hier mit meinem Buckel und möchte keinen Tag missen, den meine Inkonsequenz mir noch gebracht hat, nein, ich möchte keine Stunde missen".
"Also red keinen Unsinn", fügt sie liebevoll hinzu, hält ihre Kaffeetasse mit beiden Händen und erinnert sich nachdenklich: "Mensch, mit 56 war ich in Indien, mit 60 haben wir uns einen kleinen Wohnwagen hergerichtet und sind durch Europa gefahren und mit 65 bin ich sogar soweit gegangen, mir einen kleinen lebendigen Affen zuzulegen, als ob man nicht genug Affen um sich hätte, stell Dir das mal vor. Und die Kinder, die Enkel, die Urenkel, all das soll ohne mich stattgefunden haben, unvorstellbar..."
"Sei doch mal ernst", sage ich zu ihr, und weiß, daß das freche Ding, die Jugend aus meinen Augen verschwunden ist, "Du bist in Deiner Familie eingebettet, geachtet und geliebt, inmitten einer fürsorglichen Großfamilie, aber wie geht es anderen?"
"Ja", sagt sie, "aber das mit dem Malen zum Beispiel habe ich relativ spät begonnen, man kann dem Leben, selbst wenn man keine Familie hat, einen Sinn geben oder abgewinnen. Denk mal an die Menschen, die erst nach einem arbeitsreichen Leben dazu kommen, das zu tun, was sie schon immer tun wollten. Sie fühlen sich befreit, haben ihren Zoll an Arbeitsleben verrichtet und fangen erst mit 65 an, schöpferisch zu sein, ja, eigentlich ihr Leben zu leben".
"Hängt davon ab", unterbreche ich sie, "in was für einer Gesellschaft Du lebst, ob das Alter, oder genauer, die alten Menschen als überflüssige Belastung oder als wertvolle Brücken zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart angesehen werden".
Mir wird klar, daß Chana so sehr in ihrer guten Umgebung lebt, daß sie sich das vereinzelte und isolierte Leben alter Menschen in den Großstädten gar nicht vorstellen kann. Deshalb fahre ich fort: "Es gibt ja alte Menschen, die sich mit ihrem Haustier, Katze, Hund, Vogel, in ihrer Einsamkeit verschanzen und Barrieren errichten, wie, zu Beispiel: Nur wer meinen Hund mag, kann zu mir kommen. Dann gibt es wieder welche wie meine Großeltern, die bis zu ihrem letzten Atemzug in das Leben ihrer Familie einbezogen sind, jeden Liebeskummer der Enkelkinder kennen, sich nicht zurückziehen, sondern immer dabei sind.
Und dann wieder die, die verbittert und allein ihrem eigenen und dem Leben anderer verständnislos gegenüberstehen, - wirre Versorgungsfälle - erbärmlich."
Das Wort erbärmlich fällt mich oft an, wenn ich sehe, wie einsam vom Großstadtlärm gehetzt, ein alter, vielleicht seh- oder gehbehinderter Mensch sich durch die Menge oder einer ihn zur Eile treibenden Ampel schleppt.
Ich kann Chana das nicht ersparen, muß mit ihr darüber sprechen.
Ich habe schon als junges Mädchen die Gesellschaft älterer Menschen gesucht, weil ich so ein ungenaues aber bestimmtes Gefühl hatte, daß sie der Grund sind, auf dem wir, die nächste Generation, wachsen.
"Hör mal, Chana", wende ich mich wieder an sie, "es gibt eigentlich keine Phase in meinem Leben, in der ich nicht ältere, viel ältere Freunde hatte. Es gab mir ein gutes Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, Menschen zu kennen, die nicht mehr durch ihr Leben galoppieren, sondern schon irgendwo, in ihrem Irgendwo gelandet sind".
"Ich will nicht übertreiben", fahre ich fort, "aber ohne diese älteren Menschen hätte ich gar nicht jung sein können. Sie haben mich davor beschützt, orientierungslos zu sein, obwohl ich in vielen Fällen gar nicht sagen kann, daß sie mir direkte Lebensmuster gaben. Was sie mir in ihren verschiedenen Lebensweisen alle gaben, war die Sicherheit, daß ich Zeit habe. Zeit, mich selbst zu finden, geduldig zu werden, ohne allzu duldsam zu sein, Zeit mich zu entwickeln und Kräfte zu sammeln, sie waren und sind wie große feste Bäume, die Schatten spenden und kühlen". Chana strahlt mich an und ist gleichzeitig verlegen.
Es ist still für einen Moment zwischen uns und ich überlege, warum ich mit fast keinem in meinem Alter über das Älterwerden, ja über das Altern sprechen kann.
Es ist schon oft passiert, daß ein Freund oder eine Freundin dann gesagt hat, hast Du kein erfreulicheres Thema? Oder, findest Du es nicht ein wenig früh, Dir darüber Gedanken zu machen?
Chana unterbricht die Stille: "Ich kann nicht sagen, daß es fantastisch ist alt zu werden, sieh mich an, ich brauche eine Brille, was ich früher nicht brauchte, meine Zähne sind die dritten, und mich einfach auf das Fahrrad schwingen wie früher kann ich auch nicht mehr. Aber ich weiß, was ich will, und bin so klar, daß meine Umgebung es auch weiß. Und daß wir alle einmal abtreten müssen," - sie nennt es abtreten -, "ist klar,
oder kennst Du jemanden, der hier oben geblieben ist?" fragt sie mich schelmisch und furchtlos.
Entsetzlich, diese gnadenlose Klarheit, denke ich, aber so genau will ich es gar nicht wissen.
"Seit dem Tod meiner Mutter" sage ich zu Chana, "die für mich unsterblich war, hat sich dieser Gedanke in meinem Kopf festgesetzt. Sie war keine unsterblich gute Mutter, nein, aber sie war ein energischer, empfindlicher, widersprüchlicher und ehrlicher Mensch.
Sie hat nicht gelogen, um schön zu tun, oder zu gefallen, sie hat sich mir und ihrer Umgebung zugemutet und sie war auf ihre Weise hart und weich zugleich, voller Illusionen und gleichzeitig realistisch, mutig und ängstlich, größenwahnsinnig und kleinlaut, sie war ein Lebensatom und sie ist trotzdem gestorben, einfach so wie jeder andere auch. Da gibt es eben, wie Du, Chana, immer sagst, keine Ausnahmen. Zu meinem vierzigsten Geburtstag sagte meine Mutter mir schonungslos, jetzt bist du auch nicht mehr die Jüngste.
Ich habe für einen Moment meinen Atem in der Luft hängen sehen, so sehr war ich erschrocken.
Als sie starb, habe ich mich, obwohl ich schon 45 Jahre alt war, verlassen gefühlt. Wie ein Kind. Erst nach ihrem Tod habe ich verstanden, wieviel Lebensenergie ich allein ihrer Existenz verdanke. Wie stark ich mich gefühlt habe, obwohl wir über lange Strecken keinen Kontakt zueinander hatten, weil sie ein massiver Puffer zwischen mir und dem Ungewissen war".
"Was ist das Ungewisse?" fragt Chana mich. "Na, die Endlichkeit", antworte ich bedrängt, "das, wo ich nicht hinsehe, vielleicht auch nicht hinsehen kann. Die Tatsache, daß Menschen, die man liebt, eines Tages nicht mehr da sein werden und man selber auch nicht, so richtig vorstellbar ist das nicht, oder?" Chana schaut auf den Tisch und sagt sehr langsam, "Es kommt der Punkt, wo man sich die Endlichkeit wünscht, wo ich es in der Ordnung finde, daß man Platz machen muß.
Es ist, wenn es keine Krankheiten sind, der Zeitpunkt, in dem so viele Freunde und Angehörige nicht mehr da, gestorben sind , die Erinnerungen immer ferner rücken, die Beweglichkeit immer geringer wird. Dann wird das, was Du Ungewissheit nennst, zur Gewissheit und bringt eine Gelassenheit mit sich, nach der ich mich zum Beispiel sehne."
"Ja, aber der Weg dahin ist ein langer Weg", sage ich, "und man kann ihn bewußt gehen, man kann sich aber auch durch den Lauf der Dinge schieben lassen und hin und wieder verloren gehen, sich fremd vorkommen, hilflos sein.
Die Hilflosigkeit, die ist eigentlich das, was mir Angst macht. Die Angst, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein...
Die Altersflecken zum Beispiel. Meine Beine sind voll davon, mein Gesicht und meine Hände fangen auch schon an, ich kann doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dieses eigene Gesicht, das mich morgens traurig und verletzt aus dem Spiegel ansieht; jüngere Menschen, die einen für älter halten als man ist, oder Ärzte, die plötzlich jünger sind als man selber, das muß ich doch erst akzeptieren lernen.
Die Müdigkeit, die sich öfter einstellt als früher. Das Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Und, Chana, am Arbeitsplatz, die Kollegen, die gerade noch die Älteren waren, sind eines Tages weg und ich selbst bin dann die Älteste, und da fragt schon mal ein Jüngerer, was machen Sie, wenn Sie in Pension gehen? Oder, wollen Sie wirklich bis zur Pensionierung arbeiten? Diese Frage, die aus der Warte der Jüngeren berechtigt ist, ist eine Schiebefrage, so nenne ich das mal, mit solchen Fragen und Bemerkungen wirst du langsam hinausgedrängt und es hilft dir kein Mensch, damit fertig zu werden. Und innerlich dieses unausweichliche Gefühl: Jetzt bist du auch dran wirst zum Mohr, der seine Schuldigkeit getan hat..."
"Und das Positive?" sagt Chana herausfordernd. "Das Positive ist: Daß weiß, was ich will, daß ich auch meistens weiß, was ich kann oder nicht kann, daß ich ruhiger und sicherer bin als früher. Das Positive ist: Daß Freundschaften, langjährige Freundschaften sich mitentwickeln, vertraute Menschen werden auch älter und wir gehen miteinander liebevoller um.
Das Positive ist auch, daß deine Erfahrung als Ältere manchmal abgefragt wird, daß du dann weißt: Nichts war vergeblich. Vielleicht", fahre ich besser gelaunt fort, "vielleicht wachse ich, ohne es zu merken, in die Rolle hinein, in die Bedeutung, die für mich die älteren Menschen hatten und noch haben. Aber es ist mir neu, auf diesem Weg zu sein, es ist neu und schleicht sich mit jedem Tag ein, immer mehr, ich muß mich erst daran gewöhnen und weiß überhaupt nicht, ob ich das kann." Ich sehe Chana fast hilfesuchend an.
Chana lacht entspannt, sie legt mir ihre Hand liebevoll auf die Schulter und sagt: "Erzähl noch etwas von Deinen Großeltern, oder von den schattenspendenden Bäumen, wie Du sie vorhin nanntest, in Deinem Leben".
"Mensch, Chana, wo wäre ich heute ohne meine Großeltern? Ohne meinen rabiat gerechten Großvater, der vor einunddreißig Jahren laut aufgeheult hat, als mein schwangerer Bauch nicht mehr zu verstecken war, ich hatte nicht den Mut, ihm zu sagen, daß ich nicht heiraten wollte, und ließ ihn meine physische Veränderung selbst entdecken. Er zeigte auf meinen Bauch und fragte, "Was ist das?" Und ich sagte nur: "Ja". Er setzte sich in die kleine Küche und bat mich, ja flehte mich an, mein Leben nicht zu ruinieren. Als mein Kind dann zur Welt kam, war sein und der Schutzmantel meiner Großmutter noch weiter geworden, fast bildhaft, und schloß auch den kleinen neuen Erdenbürger ein.
Meine Großeltern hielten es für puren Wahnsinn, daß ich das Kind allein großkriegen wollte, sie ließen mich nie im Zweifel darüber, aber nicht nur, daß sie mich nie verurteilt haben; meine Großmutter sagte mir ein Jahr vor ihrem Tod, sie war damals 82 Jahre alt, "ich muß Dir gestehen, Kind, ich habe von Dir viel gelernt."
Chana hört mir geduldig zu und schaut mich an, als wollte sie noch mehr hören".
Ich fahre also fort: "Ich habe sie gebraucht, diese alte, kluge Frau, obwohl ich es natürlich fertiggebracht habe, sie auch zu ärgern und ihr auf die Nerven zu gehen, aber sie war nicht umzuwerfen, sie war für mich und meine Freunde immer da, und wenn sie es einmal aus gesundheitlichen Gründen nicht konnte, war sie unglücklich."
"Kann ich gut verstehen", sagt Chana, "Du kennst ja meinen Familienclan, es gibt nichts, was mich mehr ängstigt als die Möglichkeit, eines Tages hilflos zu sein und ihnen, den Kindern und Enkelkindern, zur Last zu fallen."
Jetzt hat auch Chana für einen Moment einen traurigen Blick, aber nur für einen Moment.
"Nichts belebt mich mehr" holt sie neu aus, "als wenn die Enkelkinder, alle heute zwischen 20 und 30 Jahre alt, zu mir kommen, sich mit mir beraten, etwas aus der Vergangenheit unserer Familie wissen wollen und einfach so bei mir sind, mir eine Art von Unvergänglichkeit geben, nichts ist schöner als das."
Ich erinnere mich gern an dieses Gespräch, weil ich heute selbst diese Belebung, diese Freude, ja den Sinn erlebe, wenn mein zweieinhalbjähriger Enkel auf meine Lippen schaut, während ich ihn pausbäckig mit dem Wort P A M P E L M U S E erfreue, oder ihm das Samtmännchen in Sandmännchen übersetze. Oma komm, sagt er und zieht mich mit seiner kleinen Hand in sein Zimmer, wo ein kleiner grauer Elefant auf seinem Bett liegt; Wie viele Augen hat Dein Elefant, frage ich ihn, fünf, sagt er...
Fünf ist im Augenblick seine Lieblingszahl und drückt eine Mehrzahl aus. Er nutzt konsequent die Erweiterung seines Wortschatzes, um seine Interessen zu artikulieren. Die ersten Worte, die er gebrauchte, waren ja und nein.
Ich entdecke an mir, daß ich die Fortschritte meines Enkels genauer beobachte als ich es seinerzeit bei meinem Sohn getan habe. Ich sehe schärfer und registriere präziser und kritischer, auch wenn ich blind vor Liebe bin. Meine Rolle ist die einer vertrauten Besucherin, die andere Lebenserfahrungen als die Eltern einbringt, weniger vom Alltag genervt und angesichts des schon absehbaren Abschiednehmens bewußter den Augenblick genießend. Ja, bei aller Nähe achte ich instinktiv darauf, für meinen Enkel nicht zu allgegenwärtig und zu selbstverständlich zu werden, weil andere ihm später erklären müssen, warum ich nicht mehr da bin.
Ich bin nicht die jederzeit ansprechbare Orientierungsinstanz, die ich natürlich für meinen Sohn war. Vertraut ja, aber nicht unersetzlich. Ein Angebot, mehr nicht.
Wieder zu Hause, nehme ich einen neuen Anlauf, sehe meinen Mann an und frage diesmal provokativ, "Du wirst also nicht älter?" Er schaut wie ein richtiger Opa hinter seiner Halbbrille zu mir auf und sagt" Nein". "Aber Deine Augen sehen auch nicht mehr so gut, und Deine Zähne werden Dir untreu, sind das nicht die ersten Zeichen?" "Laß mich, " stöhnt er und beugt sich wieder über seine Zeitung. "Mensch, erst gestern hast Du erzählt, wie ekelhaft Du es findest, daß Dein Vorgesetzter jünger ist als Du, und jetzt?..." "Laß mich" brummt er wieder.
Dieses Mal lasse ich nicht locker. "Erzähl mir von Deinen Erfahrungen mit dem Älterwerden, eher gebe ich keine Ruhe".
"Na schön", sagt er, "als ich vor zwei Jahren 50 und gleichzeitig Opa wurde, hatte ich einen Schock. Ich hätte mich am liebsten in einer Höhle verkrochen und den Tod erwartet. Die Zeit bis zum Eintritt dieses unausweichlichen Ereignisses erschien mir sinnlos und vergeudet; ich wollte sie abkürzen. Dann begegnete ich dem, der mich zum Großvater gemacht hat, Joe, und ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht. Der Anfang war nicht durch herzliche Zuneigung bestimmt, eher durch mein Erschrecken über das kleine Monster, das da, 10 Minuten nach seiner Geburt, mit einem verbeulten Kopf und puterrot vor mir lag und das seinerseits die plötzlich viel größere Welt um ihn auch nicht gerade mit Begeisterung begrüßte. Zwischen uns entwickelte sich vorsichtiges Wohlwollen, das mit einem hochspezialisierten Wortschatz auf beiden Seiten gepflegt wurde, wie es für diese Altersgruppe typisch ist.
Als sein Kopf die Phase der geburtsbedingten Knautschzone überwunden und er sich mit der neuen Welt halbwegs abgefunden hatte, teilte er mir eine nützliche Funktion zu: Er brauchte meine speziellen Lieder zum Einschlafen, unter anderem die Marseillaise. Als er anfing zu verstehen, habe ich ihm Geschichten erzählt, und er war so konzentriert und gebannt, daß ich dachte, er wird etwas davon behalten und seinen Opa nicht vergessen.
Dann habe ich noch eine Frau, die mit mir älter wird und Jemanden zum Streiten braucht, nicht irgendeinen Menschen, sondern einen, dessen Verschrobenheiten sie einschätzen kann und der sie gut kennt, und woher soll sie den nehmen, wenn ich weg bin? Die Vorstellung, daß sie mich dann an meinem Grab mit Vorwürfen überhäufen muß, erschien mir wenig erfreulich. Diese Dinge und noch anderes haben mich veranlaßt weiterzumachen." Er lächelt gequält und hält seine Zeitung immer noch fest, als wollte er gleich wieder in ihr versinken.
"Und bei der Arbeit, wie wirkt sich da das Älterwerden aus?" frage ich. "Das ist das Schlimmste" sagt er, "Erfahrungen haben einfach keinen Wert, weil sie angesichts der enormen Veränderungen auf allen Gebieten eher als hinderlich empfunden werden. Wer Erfolg haben will, muß jung sein, seine Intelligenz wie eine Monstranz vor sich hertragen und radikale Veränderungen verlangen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mein Alter mit dem der anderen Mitarbeiter der Firma vergleiche und dabei immer schlechter abschneide."
Weil er so deprimiert ist, beginne ich unser Spiel, das darum kreist, wer zuerst abtritt und den anderen zurückläßt. Keiner von uns beiden will der Hinterbliebene sein. Wir malen uns aus, wie wir noch im Grab miteinander streiten und daß die Grabinschrift "Hier ruht in Frieden..." auf uns nicht zutrifft. Wir wünschen uns unpassende Musik und witzige Sprüche zum Begräbnis. Und irgendwie erleichtert es uns, daß wir das Thema ansprechen, wenn auch in dieser verfremdeten und absurden Form. Wir versuchen, uns dem Unausweichlichen auf erträgliche Weise zu nähern.
Wie sehr wir uns schon mit dem Gedanken an das Ende vertraut gemacht haben, merken wir erst, wenn unser Sohn zu Besuch kommt und unsere Gespräche miterlebt. Er ist immer wieder entsetzt und will davon nichts hören. Wir sind der Puffer zwischen ihm und dem Ungewissen. Durch uns ist er jung, wie ich es durch meine Mutter und Großeltern war.
Vielleicht ist es ja doch wichtig, noch eine Weile den Jungen vorauszugehen und ein wenig zwischen ihnen und dem Unerklärlichen zu verweilen.
Als meine Freundin Helga vierundachtzigjährig starb, schrieb ein afrikanischer
Freund aus Jugendzeiten an den hinterbliebenen Ehemann: "Sie durfte noch lange das weiße Haar tragen, bis sie an die große Tür kam".