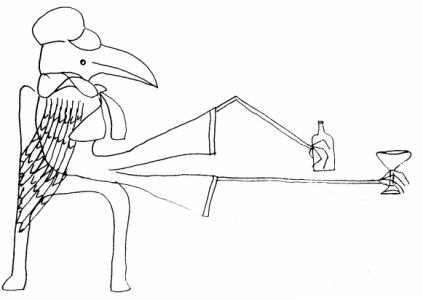
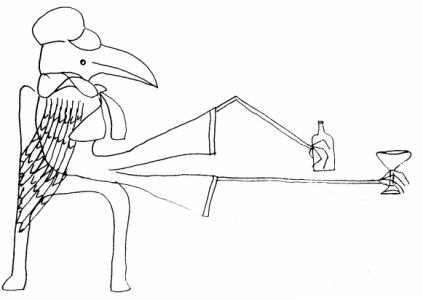
Fremdes im Vertrauten
Zumutungen an die Freundschaft
Warum gerade sie?
Warum sind gerade Sima, Ora und Ruth meine Freundinnen?
Menschen, die ihr Licht in mein Leben lassen und ihre Schatten, mich fast ein Leben lang begleiten, selbst gewählt, durch Zufall begegnet, die Wege gekreuzt.
Sie sind so verschieden wie ihre Namen und wenn ich an sie denke, sind sie mir nahe, manchmal sehr nahe, sporadisch in meinem Herzen, wie das Wetter, manchmal auch wie Bleigewichte.
Alle drei Frauen sind im Alltag verankert, tatkräftig und patent. Alle drei neigen aber auch zur Irrationalität, dazu, sich auf die außerirdischen Kräfte zu verlassen. Diese Irrationalität macht sie für mich mutig und feige zugleich.
Manchmal sind sie mir eine Zumutung.
Und ich, was bin ich ihnen?
Das Geheimnis ihrer Verbindung zum Okkulten teilen sie nur mit mir, obwohl sie wissen, daß ich davon nichts halte. Aber gerade deshalb, erklärt mir jede von ihnen, „gerade, weil Du es so total ablehnst, bist Du für uns zuverlässig“.
Sima ist der Ora zu simpel und Ora ist der Sima zu eigen.
Ruth kennt die beiden nicht.
Daß die Anfälligkeit für das Okkulte sie verbindet, weiß nur ich. Ihre Irrationalitäten sind so verschieden wie ihr Alltag. Wenn sie von ihren unheimlichen Begegnungen berichten, ist es so, als falle plötzlich an einem strahlenden Sonnentag ein langer Schatten über das Land. Die Temperatur sinkt und mich fröstelt. Aber im nächsten Moment ist es wieder so hell und warm wie vorher.
Sima:
Sima, eine große, kräftiggebaute Marokkanerin, ist die Freundin meiner Sinne. Sie riecht gut, ist schön anzusehen mit ihren großen braunen Augen und ihrem natürlich braunen Teint. Sie lehnt, wenn es kompliziert wird, jede Art von Denken ab: „Wir leben jetzt und heute, Zores haben wir genug, komm, wir wollen uns einen schönen Tag machen“. Ihren ruhigen Mann und ihre sehr lebhaften vier Kinder managt sie mit links.
Sie hat nie etwas gelernt, aber immer gute Jobs gehabt, in der Werbung, in kleinen Schneidereien und auch als Autofahrerin. Sie läßt in ihrem Leben keine Tragödien zu, ihr Fatalismus macht es ihr leicht, Schicksalsschläge in Proportionen zu sehen, sich sofort zu überlegen, was andere Menschen durchleiden müssen, und schon ist sie wieder auf den Beinen in ihrem rasenden Alltag, zwischen Beruf, Einkäufen, Bankangelegenheiten und Flirts, für die sie immer noch Zeit findet.
Ihr langjähriger Geliebter, „er behandelt mich wie eine Lady, und das brauche ich“, sagt sie, hat sich ihretwegen scheiden lassen, inzwischen aber wieder geheiratet, weil Sima nicht daran dachte, ihren Mann und ihre Familie zu verlassen. Sie galoppiert durch ihr Leben, hält kaum inne und hat die größte Parfümsammlung, die ich je bei einem Menschen gesehen habe. Schöne Flaschen und zierliche Flacons stehen auf einem großen niedrigem Tisch in ihrem Schlafzimmer und sind für sie der Griff in die große, weite Welt. Kennengelernt haben wir uns, als sie verdächtigt wurde, Traveller Schecks gestohlen zu haben. Alle um sie herum flüsterten, aber keiner sagte es ihr. Als sie sich mir vorstellte, fragte ich: „Bist Du diejenige, die die Traveller Schecks gestohlen haben soll?“ Sie lächelte mich freundlich an, als fühlte sie sich nicht angesprochen, und dann fragte sie: „Was ist das, Traveller Schecks?“
Nachdem sie meine Erklärung angehört hatte, ging sie ans Telefon, rief ihren sehr ruhigen Mann an und erzählte ihm, daß sie verdächtigt würde. Er kam sofort, befragte mich genau, wollte jedes Detail wissen und machte sich dann auf den Weg, alle Menschen, die dieses Gerücht verbreitet hatten, aufzusuchen und zur Rede zu stellen.
So haben wir uns kennengelernt, vor 15 Jahren, kennen und lieben. Jetzt sehen wir uns selten, und immer noch habe ich Sehnsucht nach ihrem guten Geruch.
Und nach ihrem klaren Gesicht, wenn ich sie bitte, ja fast anflehe, sich Gedanken über die politische Lage, über wirtschaftliche Perspektiven zu machen. Sie sieht mich etwas spöttisch und liebevoll an als wollte sie sagen: „Echte Sorgen scheinst Du im Moment nicht zu haben...“
Wenn sie ganz und gar nicht mehr weiß, wie sie ihr Lebensschiff steuern soll, geht sie zu einer Wahrsagerin, so manches Mal hat sie auch schon eine zu sich bestellt.
Woher sie die Adressen dieser Frauen mit ihren Spezialkenntnissen hat, verrät sie mir nicht. Aber sie ist davon überzeugt, daß diese Frauen ein Wissen aus dem Reich der „Kräfte“ haben, wie sie es nennt. Sie können ihr sagen, wie sie sich verhalten soll, was ihr bevorsteht und das allerwichtigste ist, sie machen sie auf Menschen und Umstände aufmerksam, vor denen sie sich hüten soll.
Einmal traf ich so eine Frau in Simas kleiner Küche. Eine vielleicht fünfzigjährige zierliche Frau in buntem langen Rock mit einem strengen, faltenreichen Gesicht. Sie kochte gerade den Kaffee, aus dem sie dann lesen wollte. Stumm zeigte sie mit der Hand auf einen freien Stuhl und fragte dann Sima, ob sie auch mir einen Kaffee zum Darauslesen kochen soll. „Na, willst Du?“ fragte Sima mich lachend.
„Nein, nein, danke“, sagte ich und zuckte wie immer bei solchen Ansinnen zurück.
Fluchtartig verließ ich die mir unheimlich gewordene Küche. „Wie kann ein Fremder über mein Schicksal Bescheid wissen?“ flüsterte ich Sima beim Hinausgehen zu.
Sima lachte laut und erklärte der Frau meine Angst. Dann war es eine Weile still.
Im Wohnzimmer sitzend und in einer Zeitung blätternd hörte ich die Frau eindringlich, Wort für Wort betonend, Sima sagen: „Du mußt in den nächsten Wochen besonders auf Deinen Sohn achtgeben, er ist wild und sollte gebändigt werden, ja, er hat Dein Temperament, er meint, keinem Rechenschaft zu schulden, gib auf ihn acht“.
Das, ging es mir durch den Kopf, hätte ich Sima auch ohne Kaffeesatz sagen können, was soll diese Zeremonie? Dann kam die Stimme wieder aus der Küche: „Dein Mann, seine Gesundheit, er muß mehr schlafen, und noch ein Kind, nein, das schlag Dir aus dem Kopf, vier Kinder reichen, meine Liebe, oder? Du verstehst mich schon...“ Sima steckte ihren Kopf durch die Wohnzimmertür: „Wir sind gleich fertig, willst Du wirklich nicht?“
Ich winkte ab und spürte eine Zärtlichkeit meiner großen schönen Freundin gegenüber. Es ist klar, daß die Wahrsagerin ihr den Psychiater ersetzt. „Die Wahrsagerin fragt mich nie, wer meine Mutter und wer mein Vater ist, sie wühlt nicht in meiner Kindheit und forscht mich nicht aus, sie sitzt mit mir vor einem Straßenplan, ich meine den Kaffeesatz, und sagt mir, welche Straßen für mich gut sind und welche nicht, das ist alles,“ sagt sie abschließend.
Simas unbefangener Umgang mit ihrem komplizierten Alltag ebenso wie mit den „Kräften“, von denen ihr die Wahrsagerinnen Botschaften bringen, macht mich zuweilen sprachlos. Von meinen Freundinnen ist sie die einzige, die das Leben dankbar so nimmt, wie es ist. Ihre Energie reißt mich mit, ihre Wärme geht auf mich über.
Meine dunklen Seiten, die Selbstzweifel, die Ängste und auch das Wissen über bedrohliche Entwicklungen überläßt sie mir. Ihr unbeirrter Optimismus hilft mir aber auch da, wo ihr das Verständnis fehlt: Die Probleme werden relativiert, die Dinge erhalten den Platz, der ihnen zusteht.
Ich habe mich lange Zeit bei Sima nicht gemeldet, weil ich beleidigt darüber war, daß sie, als sie ihre erste Auslandsreise antreten konnte, eine Freundin in Amerika besucht hat und nicht mich in Deutschland.
Inzwischen ist das Kriegsbeil begraben, weil Sima sich so über meine Eifersucht gefreut hat, daß ich ihr nicht länger böse sein konnte.
Ora:
Ora ruft mich mindestens einmal in der Woche an, es ist ein schon seit Jahren geübtes Ritual, und dann erzählen wir einander von unseren Kindern, von der Arbeit und von den Sorgen, die uns umgeben.
Ora ist Sonderschullehrerin und Therapeutin, deshalb hat sie immer ein paar Puppen in der Tasche, ein paar Stofftiere und irgendeine kleine Geschichte im Kopf, die sie notfalls jederzeit hervorzaubern kann, wenn sich ein Konfliktfall einstellt und sie eine Szene nachstellen will.
Ihr Gesicht ist eine Katastrophe, zumindest auf den ersten Blick. Eine unförmige, große Nase nimmt in der Mitte soviel Platz ein, daß kaum Platz für ihre kleinen dunklen Augen zu sein scheint und den welken Mund. Ein rötlich getönter Kraushaarschopf umrahmt dieses disharmonische Bild, das auf einem perfekt gebauten Körper thront.
Es ist nicht selten vorgekommen, daß Menschen, die Ora zum erstenmal begegneten, „Mein Gott“, sagten... Dieser erste Eindruck verfliegt aber im Nu, wenn sie zu sprechen beginnt. Wo auch immer sie ansetzt, sie ist gegenwärtig, humorvoll und souverän. Ihr Aussehen ist dann kein Thema mehr.
Ihre Eltern waren schon alt, sagt sie, als sie auf die Welt kam, ihre Mutter war 45 und ihr Vater 60. So hatte sie immer das Gefühl, bei Großeltern aufzuwachsen.
Als sie 11 Jahre alt war und ihre Mutter ihr verboten hatte, auf ein Kinderfest zu gehen, wünschte sie ihrer Mutter den Tod. „Ich wünsche mir, daß Du tot wärst, habe ich zu ihr gesagt“, erzählt sie „und zwei Stunden später war sie wirklich tot“. Sie erzählt es unsentimental, nicht schicksalsergeben, sondern eher mit einem unausgesprochenen, immer noch etwas erstaunten „Stell dir das mal vor!“
Sie kam dann in ein Internat, weil der verwitwete Vater nicht für sie sorgen konnte. „Und das war meine Rettung“, sagt sie, „dadurch war ich ein Kind unter Kindern und nicht das Ergebnis einer Tragödie“.
Ora war mit einem farblosen Ingenieur verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Jahrelang kam sie dem nach, was, wie sie meinte, die Gesellschaft von ihr forderte, Mutter, Ehefrau und berufstätig zu sein. „Ich war nicht unglücklich, aber auch nicht zufrieden, ein Alltagsmensch im Alltag“, sagt sie und lächelt dabei, „bis Birgit kam und ich mich so in sie verliebte, daß ich alles stehen- und liegengelassen habe“. Die dicke Querfalte über ihre unschöne Nase wird tief, wenn sie lacht, und sie lacht wie jemand, der sich gerettet fühlt. „In der Schule bin ich ins Lehrerzimmer gegangen und habe allen nach einer Sitzung mitgeteilt, daß ich lesbisch bin. Ich wollte selbst alles klarstellen, ehe irgendwer von außen das macht“. Konsequent hat sie das alleinige Sorgerecht für die drei Kinder ihrem Mann überlassen und ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, weil sie weder den Kindern noch sich selbst eine Auseinandersetzung zumuten wollte, die ihrem Mann Gelegenheit geben würde, ihre erotischen Neigungen aufzurollen.
Als der Mann mit ihren Kindern in eine andere Stadt umzog, rief sie mich an: „Komm her, es tut so weh, ich ertrage es nicht und ich weiß, daß es trotzdem richtig ist“. Als ich bei ihr eintraf, war sie völlig aufgelöst, weinte und stammelte, „es ist aber richtig so, es ist aber richtig so...“
Sie ist der einfallsreichste Verehrer, den sich Frauen nur wünschen können. Wenn ihre Neugier, Sympathie, Liebe für eine Frau geweckt ist, setzt sie alles daran, zum Ziel zu kommen, erst große Kreise und dann immer kleiner werdende Kreise um die verehrte Person zu ziehen.
Sie trifft Zielpersonen wie zufällig. So hat sie es auch eingefädelt, vor vielen Jahren, als wir uns kennenlernten. Sie spinnt ein Zaubergarn von Konzerteinladungen, Ausflugsvorschlägen, Theaterbesuchen, sie verwandelt sich buchstäblich in einen Veranstaltungskalender, beobachtet die Tagesabläufe der Verehrten, taucht auf und ist wie allgegenwärtig und beendet den Schmetterlingsflug entweder, wenn sie am Ziel ist, oder wenn sie abgeschmettert wird, und das alles ohne einen Hauch ihrer Würde und Selbstachtung zu verlieren. Ihre Berichte über ihre Erfolge wie über ihre Niederlagen sind offen, unverlogen, geradeweg. Sie läßt sich auf Erfahrungen ein, denen ich mich nicht stellen würde, vor denen ich Angst hätte und für die ich auch zu spießig wäre.
„Ich habe an einer Seance teilgenommen bei einer Frau, die Kontakt zu den Toten herstellen kann“, sagt sie mir eines Tages, als wir in ihrer kleinen Wohnküche sitzen. Ich sehe Ora erschrocken an und sie amüsiert sich sichtlich, sie hat nichts anderes von mir erwartet. „Laß den Unsinn, ich will es gar nicht hören“ unterbreche ich ihren Redefluß. „Hör mir doch zu“, sagt sie drängend, „es ist mir wichtig und ich weiß selbst, daß es nicht ungefährlich ist“.
Ich will ihr nicht zuhören. Bei solchen Themen habe ich immer Angst, angesteckt zu werden, in Dinge hineingezogen zu werden, die ich nicht übersehen kann, die mich an etwas glauben lassen, an das ich nicht glauben will.
Ich will mich nicht in die Hände von Menschen begeben, die unerklärbare Welten aufrufen, Zeremonien veranstalten, in einen Sog geraten, der mich ihnen ausliefert. Dennoch höre ich Ora zu. Unsere Freundschaft zwingt mich dazu. Es ist ihr wichtig: „Ich wollte, daß dieses Medium meine Eltern aufruft, weil ich ihnen sagen wollte, daß ich lesbisch bin, daß ich beschlossen habe, mein Liebesleben nur noch mit Frauen zu teilen“.
Ora geht mir auf die Nerven und ich finde ihre Begründung absurd, sehe sie dumpf an, bleibe widerwillig sitzen, und sie fährt hartnäckig fort: „Es war still, es waren außer mir und dem Medium noch fünf andere Menschen da, die ihre toten Verwandten anrufen wollten. Die Frau versetzte sich in Trance und dann hörte ich aus ihrem Mund zuerst die Stimme meiner Mutter und dann die meines Vaters, eindeutig“.
„Ora, jetzt reicht’s, laß mich in Ruhe!“ unterbreche ich sie. „Nur noch einen Moment, hör doch bitte zu“, drängt sie. „Auf ein Zeichen der Seancefrau bin ich aufgestanden und habe meine Eltern gefragt, ob sie da sind. Nacheinander antworteten sie aus ihrem Mund: Ja. „Ich wollte Euch sagen, daß ich lesbisch bin, daß ich Frauen liebe“.
Mit einem Schlag standen alle fünf anderen Seancegäste auf, die Seancefrau öffnete die Augen und sah mich böse an. „Du störst die Ruhe der Toten, um ihnen so einen Unsinn zu erzählen?!“, zischte sie mich an, deutete mit ihrem Zeigefinger empört auf die Tür und sagte: „Raus!“.
„Siehste!“ sage ich zur Ora, die mir diese Geschichte aufgedrängt hat, „geschieht Dir recht!“ Gleichzeitig überlege ich, wie ich mich fühlen würde, wenn ich irgendwo rausgeschmissen werden würde. Ich würde es niemandem erzählen. Ora erzählt aber über Siege und Niederlagen in der Natürlichkeit, in der die Dinge geschehen, und sie betritt furchtlos Gebiete, die ich nicht im Traum zu betreten wagen würde.
Einmal hat Ora mich im Winter in Deutschland für 10 Tage besucht. Dadurch weiß sie jetzt - so sagt sie - wie ich heute lebe. Sie hat allerdings kein Verständnis dafür, daß ich den Schnee und die Kälte, die sie so schnell aus Europa wieder vertrieben haben, ertragen kann.
Ruth
Ruth ist klein, rothaarig und sommersprossig. Sie war viele Jahre Schiffsstewardess im östlichen Mittelmeer, auf Schiffen, die zwischen Italien, Griechenland und Israel pendelten. Auf so einem Schiff haben wir uns kennengelernt. Die Durchsagen für die Besuche an Land machte sie auf Italienisch, Englisch, Griechisch, Deutsch und Hebräisch, perfekt.
Sie hat eine Schauspielausbildung, eine Ehe und viele Versuche, sich in verschiedenen Berufen an Land zu etablieren, hinter sich. Ihre Stimme, tief und rauchig, paßt nicht zu ihrer kleinen sportlichen Statur. Eine Nachtmenschenstimme kommt aus ihr heraus, wann immer sie spricht. Ihre Arbeit auf den Schiffen wurde nicht gut bezahlt, aber die Tatsache, daß sie ständig anderen Ländern und Menschen begegnete, daß es buchstäblich keinen Stillstand in ihrem Alltag gab, machte das wett.
Auf den ersten Klang hin mochten unsere Stimmen einander, und so fand ich mich an ihrem freien Nachmittag in ihrer schönen, chaotischen Schiffskoje, und sie sagte: „Es ist gut, daß wir uns kaum kennen, so kann ich Dir meine letzten Erlebnisse erzählen, ohne daß Du glaubst, ich sei verrückt.“ Sie schenkt uns herben weißen Wein in die blinden Zahnputzgläser ein, die auch so nicht sehr appetitlich sind, und fängt an. „Ich war gerade in Paris, habe dort einen Freund besucht, der Maler ist und eine wunderbare Villa bewohnt, fast eine Woche war ich dort, es ist eine phantastische Stadt.“ Das leise Geräusch der Schiffsmotoren begleitet monoton ihre Geschichte. „In einem Café verabredete ich ein Wiedersehen mit einer Freundin, und als ich sie traf, war ein junger, dunkelhaariger, sehr blasser Mann bei ihr. Als ich kam, stand er hastig auf, küßte meine schon etwas ältere Freundin merkwürdig lange seitlich auf den Nacken und ging“.
Sie nimmt einen Schluck vom weißen Wein und setzt neu an: “Meine Freundin erzählte mir, daß er ein junger Imker aus dem Pariser Umland ist und daß er die vielfältigsten Honigsorten im Angebot hat, roten Honig, grünen Honig, gelben Honig und orangenen, je nachdem welchen Nektar die Bienen zu sich genommen haben. Noch während sie von ihm erzählte, kam der Jüngling zurück und lud mich ein, einen Blick in seinen Wagen zu werfen, der eine Straßenecke weiter geparkt war.
Es war schon dunkel und, neugierig wie ich bin, ging ich mit ihm zu seinem Wagen. Er öffnete die Tür, klappte den Vordersitz nach vorne und öffnete einen Karton nach dem anderen. Er fragte mich, welchen Honig ich probieren möchte. Albern und leichtsinnig wie ich war, sagte ich: „alle!“. Ruth macht eine Pause, steht auf und schaut durch das Bullauge auf das ruhige Meer. Sie schlägt vor, daß wir an Deck gehen. Ich stimme zu. Wir nehmen in zwei Liegestühlen auf dem Sonnendeck Platz und Ruth fährt fort: “Er war sehr blaß und schlank und die schwarzen Haare, die sein Gesicht umrahmten, gaben seinen Gesichtszügen etwas Ätherisches.
Das bleiche Gesicht, der dunkle Umhang, den er trug, die nächtliche Honigprobe, der seltsame Kuß auf den Nacken meiner Freundin - ob Du es glaubst oder nicht, ich mußte auf einmal an Vampire denken.
Er öffnete ein Glas Honig, steckte seinen Zeigefinger hinein und hielt mir diesen honiggetränkten Finger hin, ich kostete den Honig von seinem Finger und er wiederholte dieses Zeremonie aus verschiedenen anderen Gläsern, als mir plötzlich durchs Hirn schoß, daß meine Mutter mir einmal erzählt hat, Honig sei das beste Mittel, jemanden zu vergiften. Ich erschrak so sehr, daß ich aufsprang und wortlos die Flucht in die nächste Metrostation ergriff“. Ruth nimmt ein Tuch aus ihrer kleinen Handtasche, tupft sich die Stirn ab und sagt: „In der Metro fiel mir ein, daß ich mich zuvor mit dem Imker zu einem Museumsbesuch am nächsten Tag um 12.oo Uhr mittags verabredet hatte.
Als ich in der Villa des Malers, meines Gastgebers, angekommen war, schlief er schon, deshalb legte ich ihm einen Zettel hin, er möchte mich rechtzeitig um 11.00 Uhr wecken“.
Ein Schiffsoffizier, der an uns vorbeigeht, fragt Ruth etwas auf Griechisch, sie antwortet ihm kurz und wendet sich mir wieder zu: „Was soll ich Dir sagen, mein Malerfreund hat den Zettel nicht gefunden, und so wachte ich erst eine Stunde nach unserer verabredeten Zeit auf, ich war wütend und warf meinem Gastgeber vor, ich hätte seinetwegen eine Verabredung versäumt, die mir wichtig war, und erzählte ihm von dem jungen Imker.
Mein Gastgeber hörte mir lächelnd zu und sagte dann ruhig: „Sei froh, daß Du nicht zur Verabredung gegangen bist, dieser Imker ist einer der Anführer einen kleinen Intellektuellensekte, in der sich die auserlesenen Mitglieder kleine Bisse in den Nacken versetzen, um ihren Geist untereinander auszutauschen“.
Ich schaue mich nach der Geschichte vorsichtig um, um sicherzugehen, daß ich mich in der Wirklichkeit befinde, und Ruth lächelt und sagt, „Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, würde ich es auch nicht glauben“.
Als sie Abends wieder Dienst hat, meide und beobachte ich sie zugleich. Sie nimmt es sehr wohl zur Kenntnis und fragt mich bei jeder Gelegenheit im Vorbeigehen: „Du glaubst es immer noch nicht, stimmts?“
Jahre später, bei einem ihrer Besuche in Deutschland, während ihres Landurlaubs, sagt sie mir, daß sie genau weiß, daß ich ihr die Geschichte glaube. Ich weiß, daß Ruth dieses Erlebnis nicht erfunden hat, sie weiß aber nicht, daß mich die Warnung ihrer Mutter, Honig sei ein gutes Vehikel für Gift, am meisten beeindruckt hat...
Ruth lebt heute in Australien. Sie hat sich im Känguruh-Land festgesetzt, wie sie Australien nennt. Zwischen uns hat sich nichts geändert, außer daß die Postwege länger und die Telefonrechnungen höher geworden sind.
Meine drei Freundinnen habe ich jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen. Sie leben alle weit von Deutschland entfernt. Die vielen Kilometer, die uns trennen, bedeuten aber nicht, daß wir keine Verbindung zueinander haben. Wir sprechen miteinander regelmäßig am Telefon und wir schreiben einander. Wenn wir uns nach Jahren wiedersehen, werden wir die neuen Falten, die grauen Haare, erst die äußerliche Veränderungen und dann die weitergehenden feststellen.
Sie sind in mein Leben verwoben, diese drei abergläubischen Frauen, die fest in der Realität stehen und nur so eine kleine irrationale Ecke haben, jede für sich, wie einen verborgenen Schrein.
Sie teilen mit mir ihr Geheimnis und ich möchte es nicht missen.