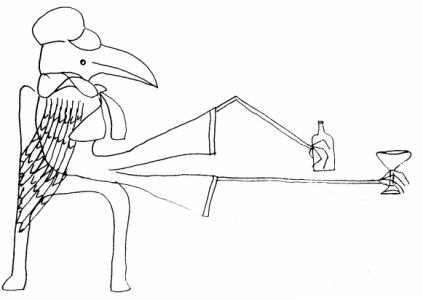
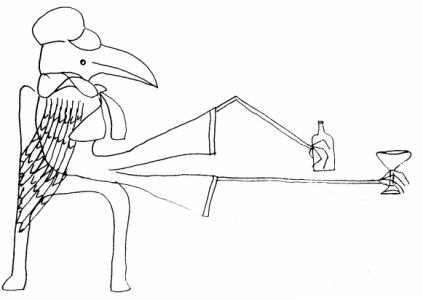
Gombutschka
Die Geschichte einer kleinen runden ungarischen Frau
1. Sprecherin:
Zum ersten Mal besuche ich Davides Mutter.
Sie thront, anders kann man es nicht nennen.
Die alte Frau in der kleinen Einzimmerwohnung im Kibbuz Achsiv, im Norden Israels, kann schon lange nicht mehr sitzen. Das erklärt sie mir gleich, als ich den Raum betreten habe, in dem sie tagsüber mit ihrem Mann lebt und nachts schläft.
Ihren richtigen Namen habe ich nie gewußt. Aber genannt wird sie von allen Knöpfchen, „Gombutschka“ auf Ungarisch.
Gombutschka nennt man in Ungarn liebevoll kleine runde Frauen. Davids Mutter war schon immer eine kleine runde Frau.
„Du bist der Grund dafür, daß ich noch lebe, ich hab’s gleich gespürt, als Du hier hereinkamst“, sagt sie ruhig und sieht mich eindringlich an. Erst jetzt bemerke ich, daß ihr linkes Auge taub ist; blind von einer bläulich-weißen Haut überzogen, die sich jedem Augenaufschlag anpaßt.
Das kleine Zimmer ist so vollgestellt, daß man sich seitlich durch die schmalen Lücken zwängen muß, um zwischen den vielen Möbeln von einem Platz zum anderen zu gelangen. Ein großer Fernseher, zwei Stahlbetten, in kleines Fenster, das nicht viel Licht hereinläßt, eine Sitzecke mit vielen kleinen selbstgehäckelten beigefarbenen Deckchen und ein Tisch, auf dem die Tageszeitungen, viele Medikamente, ein Spucknapf und diverse Brillen kaum Platz lassen, um eine Tasse abzustellen.
Gombutschka thront auf einem hellgrünen plastikbezogenen Sessel, dessen Sitzfläche sie mit buntbestickten Kissen erhöht hat.
Auf einem kleinen Regal stehen Familienfotos, die von der altmodisch bräunlich getönten Sorte. Gleich daneben an der Wand hängt ein kleiner weißer Läufer, auf den in ausgesucht grellen Farben acht Namen gestickt sind.
Gombutschka hat kein schönes Gesicht mehr und es gibt auch keine Hinweise darauf, daß sie einmal schön gewesen ist.
Sie trägt einen einfachen ärmellosen Baumwollkittel. In ihrem blassen Gesicht wachsen Haare, unendlich viele lange graue Haare am Kinn und einige auch über ihrer Oberlippe.
„Dir werde ich meine Fähigkeiten beibringen, Du bist die geeignete Person dafür“, fährt sie fort, nachdem sie ihren Spucknapf mit ihrem einen Auge erfaßt hat.
Ich weiß nicht, wovon sie spricht.
Ihr Mann, ein freundlicher schweigsamer Mensch, hantiert klirrend in der kleinen Küchenecke mit Gläsern, in die er frischen Mangosaft für uns eingießt. Es ist ein heißer Tag.
Mein Freund David sitzt mir gegenüber und lächelt mich aufmunternd an, als wollte er mir sagen, - fühl Dich wie zu Hause.-
„Ich war eine schlechte Schülerin damals in Budapest in meiner Kindheit,“ sagt Davids Mutter zu mir gewandt, „aber in Mathematik war ich sehr gut, da konnte mir keiner etwas vormachen.“
Ich nicke verlegen und begreife nicht, was diese mir völlig fremde Frau von mir will. Ich bin höflich und aufmerksam, wie es immer ist, wenn mir jemand auf die Nerven geht.
„Mein Auge war der Preis“, setzt Gombutschka neu an, „der Preis dafür, daß ich mich nicht an mein Gelübde gehalten habe...“. Ich räuspere mich, bitte um Entschuldigung und stehe auf, um in den kleinen Vorgarten zu gehen, weil ich eine Zigarette rauchen möchte.
Gombutschka spuckt in ihren Spucknapf, wischt sich die Mundwinkel mit einem Stofftaschentuch ab, drückt sich schwer aus ihrem „Thron“ heraus und kommt mir hinterher. Wir setzen uns an den Gartentisch.
„Du mußt nicht vor mir weglaufen“, sagt sie, „ich versuche immer gleich über das für mich Wesentliche zu sprechen, ich bin jetzt 80 Jahre alt und weiß nicht, wieviel Zeit mir der liebe Gott noch gibt.“
Die hohe Akazie im kleinen Vorgarten steht in voller weißer Blüte, Vögel schwirren kabbelnd in den Ästen und lenken meine Augen auf den Baum.
- Irgendwie bedrängt mich diese alte Frau, was will sie von mir? -
Sie sieht mich amüsiert an und wischt mit ihrer kleinen weißen Hand über den Tisch, auf dem meine Zigarettenschachtel liegt.
Wieder ergreift sie das Wort: “Hör mir einfach zu, bitte,“ sagt sie, „ich bin weder gaga noch will ich aufdringlich sein, aber meine Lebensuhr läuft ab und ich weiß genau, daß der liebe Gott mich so lange am Leben halten wird, bis ich eine Nachfolgerin finde, der ich mein Wissen vermachen kann, und ich sehe Dir an, daß Du diejenige bist, bitte hör mir zu“.
Ich nicke ihr zu, bin mir noch unsicher, was sie meint. Sie steht auf und schlurft in die kleine Wohnung, sagt ihrem Mann und ihrem Sohn David etwas auf Ungarisch, nimmt ihren kleinen Spucknapf mit, stellt ihn auf den Tisch neben meine Zigaretten und ich sehe, daß auf ihrem Arm keine kleine blaue Zahlenreihe tätowiert ist, darauf achte ich bei alten Israelis immer.
Ihr breitschultriger Mann kommt mit einem Tablett heraus, stellt uns Tassen auf den Tisch und eine Kanne wohlriechenden Kaffees. Er lächelt und verschwindet wieder, stumm wie er gekommen ist. Unvermittelt sagt Gombutschka:
„Weißt Du, die Shoa in Budapest zeigt sich mir in der Erinnerung wie ein Schwarzweißfilm aus dem Archiv. Was diese Zeit angeht, kriege ich keine Farben in mein Gedächtnis, schwarzweiß, immer nur schwarzweiß...“,
Sie drückt die Hände ihres Sohnes David, der inzwischen auch in den Vorgarten gekommen war und ihr seine Hände auf die Schultern gelegt hat, fester an sich.
David sagt, daß wir jetzt gehen müssen und verspricht seiner für einen Moment enttäuschten Mutter, daß wir uns am kommenden Schabbat wieder einfinden werden.
Als wir langsam zum Kibbuztor herausgehen, sagt David: „Diese Frau solltest Du nicht unterschätzen. Sie war ein Berserker und ist es eigentlich heute noch“. Ich sehe ihn im Gehen fragend an und er fährt fort: „“Sie hat es mit ihren Diensten für die SS-Offiziere in Budapest fertiggebracht, daß wir, meine zwei Geschwister und ich, nicht ins Konzentrationslager mußten“.
„Dienste für die SS-Offiziere?“ Ich sehe David an. Er lächelt, als habe er meine Ungeduld, die ihm schon oft lästig war, erwartet. „Benni und Ada, meine Geschwister, sind ihre Kinder aus erster Ehe. Wer mein Vater ist, ist selbst meiner Mutter unbekannt. Ich bin in der Zeit entstanden, in der sie schon Witwe war. Etwa ein Jahr, nachdem ihr Mann, der Vater meiner Geschwister, in Auschwitz umgebracht worden ist“.
Wir steigen in sein Auto und fahren nach Hause und ich spüre, daß sich endlose Fragen in meinem Kopf zusammenbrauen. Wir schweigen. David hält kurz vor seiner Wohnung an, stellt den Motor ab, schüttelt den Kopf, läßt den Wagen wieder an und sagt: „Du willst meine Geschichte gar nicht kennenlernen, da ist Dir zuviel Shoa drin, laß uns noch einwenig herumfahren“. Ich bin ihm dankbar, dankbar dafür, daß er mich durchschaut hat. Während ich weiterhin schweige und er das Auto langsam und ziellos durch die Gegend steuert, wird mir klar, daß ich müde bin, müde von den unzähligen Geschichten über die zerstörten Biographien der Shoaüberlebenden.
„Haben die Deutschen immer noch so wunderbar blankgeputzte Stiefel?“, bricht er in die Stille ein.
Ich muß es ja wissen, denn ich habe lange in Deutschland gelebt.
„Was für wunderbar blankgeputzte Stiefel?“ frage ich kurz und in einem Ton, der unmißverständlich klarmacht, daß ich auf seine Provokation nicht eingehen werde.
„Du denkst, ich will Dich provozieren, will ich aber nicht. Du sollst nur wissen, daß für mich, noch aus meiner Kindheit in Budapest, die Deutschen aus wunderbar sauberen Uniformen und edlen schwarzen Lederstiefeln bestehen.
Das ist gar nicht böse gemeint, ich war damals so klein, daß ich sie von ihrer Hüfte abwärts wahrgenommen habe, und wenn ich mich anstrengte und zu dem oberen Ende dieser Menschen hinaufschaute, war da vielleicht noch ein bunter Orden auf der Brust“.
Jedes Mal wenn wir über die Vergangenheit sprechen, gibt es Streit und Spannung zwischen David und mir, so wie es sich jetzt wieder ankündigt. Eigentlich sind wir schon mitten drin. Weil ich das Feuer nicht anfachen will, schweige ich und hoffe heimlich, daß uns irgendeine Alltäglichkeit unterbricht, aus dem Thema herausträgt.
„Du lebst doch heute in Deutschland, Du bist der einzige Mensch, der mir etwas über das heutige Deutschland erzählen kann“, setzt David neu an und lenkt das Auto wieder auf den Heimweg.
Ich bin es leid, ihm immer wieder zu versichern, daß das heutige Deutschland ein ganz anderes ist als vor fünfzig Jahren. Es hilft auch nicht, daß er weiß, daß meine besten Freunde in Deutschland leben, Menschen, mit denen ich von meinem vierzehnten Lebensjahr an aufgewachsen bin. Er weiß, daß ich einen Sohn in Deutschland habe, der kein einziges hebräisches Wort spricht, der sein und mein Israel mit kritischen Augen sieht, dem es im Leben nicht einfallen würde, sich in unseren israelischen Patriotismus hereinziehen zu lassen...
Als David die Tür zu seiner Wohnung aufschließt, klingelt das Telefon und seine Mutter am anderen Ende der Leitung vergewissert sich, daß wir am kommenden Schabbat wiederkommen werden.
Er hält den Hörer an sein Ohr und sieht mich fragend an, ich nicke ihm mein Einverständnis zu und er verspricht seiner Mutter, daß wir kommen werden.
Der Alltag verschluckt uns wieder, ich gehe unter der Woche meiner Tätigkeit als Reporterin für eine kleine Zeitung nach und er unterrichtet nach wie vor das Fach Geschichte.
Die Woche vergeht wie im Flug und wir sitzen wieder in seinem Wagen auf dem Weg zu Mutter Gombutschka in den Kibbuz im Norden.
In den Akazienblüten vor dem kleinen Haus seiner Eltern wimmeln die Bienen, der kleine weiße Tisch im Garten ist üppig mit Obst, Kuchen und Kaffee gedeckt, sie hat das gute Geschirr herausgeholt und sich ein Schabbatkleid angezogen, mit einem schönen hellblauen Einsatzkragen, auf dem selbstgemachte Stickereien zu sehen sind. „Feinste ungarische Handarbeit“, sagt sie lachend und zeigt mit ihrem Finger auf den Kragen. „Setzt Euch“, sie atmet aus und entläßt das lange Warten aus ihrem Körper.
Kein Kittel, kein Spucknapf, keine Haare mehr im Gesicht, ich freue mich, daß diese kleinen Zumutungen verschwunden sind und uns nicht wieder dazu zwingen, von der Tristesse in Gombutschkas Alltag gefangen genommen zu werden.
„Hab keine Angst,“ sie streichelt mir über den Arm, „ich will nur nicht, daß meine Geschichte mit mir stirbt“.
Ihr freundlich schweigsamer Mann kommt aus dem kleinen Häuschen, er begrüßt uns herzlich und gießt uns allen den Kaffee ein. Gombutschka weist mich auf die Anemonen hin, die im kleinen Garten zu blühen begonnen haben. „In jedem Jahr wünsche ich mir aufs Neue, den Frühling noch einmal zu erleben. Wie es aussieht, schaffe ich es in diesem Jahr wieder“, sie lächelt verschmitzt und ich ahne schon, daß sie mir ihre Geschichte nicht erlassen wird.
Ihr Mann erzählt leise und freundlich, welche Gartenarbeiten er schon verrichtet hat im Laufe der Woche, und wer von den jungen Kibbuzniks ihm dabei geholfen hat.
Nach dem Kaffeetrinken stehen David und sein Stiefvater auf und gehen in die kleine Kibbuzsynagoge. Wir Frauen bleiben sitzen, und als die Männer außer Hörweite sind, sagt Gombutschka:
Sprecherin 2:
„Ich habe mein Auge verloren, weil ich mein Gelübde gebrochen habe. David hat Dir sicher erzählt, daß ich während der Nazizeit in Budapest Seancen abgehalten habe, für die Frauen der ungarischen Kollaborateure, die die Cafehäuser bevölkert haben. Es waren meist sehr elegante Damen. Sie lieferten sich auf gesellschaftlicher Ebene eine Schlacht des Sehens und Gesehenwerdens. Ein alter, mit mir von Kindheit an befreundeter Kellner hat mich in diese Gesellschaft eingeschleust...
Du weißt, daß es nach unserer jüdischen Religion verboten ist, dem lieben Gott ins Handwerk zu pfuschen, aber die Menschen wollten Kontakt zu ihren Verstorbenen herstellen und ich war ein gutes Medium, Du wärst sicher auch ein gutes Medium, deshalb habe ich gemeint, ich könnte Dir mein Wissen vermitteln.“
Sprecherin 1:
Sie nimmt einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse und fährt fort:
Sprecherin 2: „Schon das Stören der Totenruhe ist nach unserer Religion strengstes verboten, das weißt Du, und ich weiß es auch, aber ich mußte Geld verdienen, um drei kleine Kinder durchzubringen, und Seancen abhalten war fast das einzige, was ich konnte“.
Sprecherin 1: Fast, denke ich, wieso sagt sie fast?
Sprecherin 2: „Ich hatte Glück, einige der deutschen SS-Offiziere fanden Gefallen an mir, das habe ich genutzt, ich war ihnen anderweitig zu Diensten und so ließen sie die Kinder und mich in Ruhe, sie hätten mit mir auch nichts anfangen können, wenn sie mich ins KZ gebracht hätten“.
Sprecherin 1: Ich höre ihr gespannt zu und merke, daß die Dinge, die sie in so kurze umschreibende Sätze faßt, ein furchtbarer Alltag waren, viel länger und ungewisser als diese paar Sätze.
Sprecherin 2: „Keiner kann mich heute eine Nazihure nennen, ich habe dafür, daß ich die Gespielin von SS-Offizieren war, keinen Pfennig bekommen, dieses Tun sicherte nur das Überleben meiner Kinder. Für die Seancen habe ich Geld bekommen, viel Geld, und so konnten wir überleben und später auch fliehen“.
Sprecherin 1:Sie steht auf, geht in das kleine Häuschen und kommt mit einem alten Bilderalbum wieder heraus. Auf kleinen Fotografien mit weißgezahntem Rand sind Zelte zu sehen, eng beieinanderstehende Zelte.
„Sieh mal,“ sagt Gombutschka, „das ist das Zeltlager auf Zypern, in dem ich mit den drei Kindern drei Monate lang festgehalten wurde, ehe die Engländer uns die Einreise nach Palästina gestatteten“.
Während sie spricht, entspannt sich ihr Gesicht, so als würde sie gerade jetzt die Einreiseerlaubnis bekommen, endlich mit ihren Kindern in Sicherheit sein.
Wir lächeln einander zu, wir sind beide an einem Punkt angekommen, an dem wir freundlich miteinander umgehen können.
„Gombutschka“, sage ich leise, „Was war das für ein Gelübde, das Du abgelegt und gebrochen hast?“ Sie legt ihre Hand auf meinen Arm und sagt:
„Als wir endlich in Palästina waren, habe ich beschlossen, ein neues Leben zu beginnen und nie wieder Seancen abzuhalten. Ich hatte keine Sorgen mehr, die Kinder durchzubringen. Es war damals klar, daß hier jeder für jeden aufkommen wird, und die Kinder waren unser kostbarstes Gut“. Ich nicke und sie fährt fort: „Aber die Versuchung war zu groß; es gab auch hier einige Menschen, die noch aus Ungarn von meinen Fähigkeiten als Medium wußten. Sie boten mir viel Geld an, um ihre Toten aufzurufen, vor allem die Toten, die in den Konzentrationslagern umgekommen waren.
Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, und so trafen wir uns einmal wöchentlich und hielten wieder Seancen ab. So fanden einige meiner Kunden Trost und gaben ihre ermordeten Angehörigen nicht verloren...“
Sie hält einen Augenblick inne und fährt dann fort: „Für das Geld, das ich dafür erhielt, kam ich schneller an einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und andere Gegenstände, zu denen ich auf normalem Wege viel später gekommen wäre. - Der Mammon - “, stöhnt sie.
Es ist still zwischen uns, die Sonne verbreitet ein gleißendes Licht, die prallen Farben des Morgens sind verblaßt, die Luft flimmert in der Hitze. Fast unbemerkt sind die beiden Männer aus der Synagoge zurückgekehrt, jetzt bringen sie uns kaltes Zitronenwasser mit Eiswürfeln in den kleinen Vorgarten, Gombutschkas freundlicher Mann hat sein Käppchen noch auf dem Kopf.
„Ja, die Geldgier,“ nimmt Davids Mutter den vorhin unterbrochenen Satz wieder auf. „Zwei Jahre habe ich hier weitergemacht, bis es eines Tages während einer solchen Seance passierte. Ich spürte einen sehr starken Druck in meinem linken Auge und dann war es wie eine große innere Explosion. So verlor ich das Augenlicht auf diesem Auge und seitdem sieht es so häßlich aus“. Sie schweigt wieder einen Moment lang. „Aber ich wußte, als und während es geschah, wofür das der Preis war. Man darf dem lieben Gott nicht ins Handwerk pfuschen“.
„Gombutschka,“ sage ich, „warum willst Du, daß ich Deine Fähigkeiten erlerne? Soll ich auch ein Auge verlieren?“
Sie sieht mich mit ihrem gesunden rechten Auge ernst an. „Es ist eine wunderbare Gabe“, erwidert sie, „ich glaube, daß Du sie auch hast. Aber sie ist gefährlich, sehr gefährlich. Man muß klug sein, wenn man sie einsetzt, klüger als ich es war. Vielleicht bist Du ja klüger“.
„Nein“, sage ich, „ich bin nicht klüger. Ich hätte auch nicht den Mut, mich Kräften auszusetzen, die ich nicht beherrschen kann. Mein ganzes Leben lang habe ich Angst vor Situationen, in denen ich anderen Menschen oder anderen Kräften ausgeliefert bin. So etwas würde ich nicht machen“.
Sie steht auf, geht in die kleine Wohnung, hält inne, dreht sich noch einmal zu mir und fügt mit einer abwinkenden Handbewegung hinzu:
„Seit der Geschichte mit dem Auge mache ich keine Seancen mehr. Diese Fähigkeit wird wohl mit mir sterben, denn Du willst es ja nicht lernen“. Ich sehe ihr nach, wie sie in der kleinen Wohnung verschwindet.
David setzt sich zu mir, er spürt, daß ich unsicher bin. „Ist Deine Mutter jetzt sehr unglücklich?“ Er fällt mir fast ins Wort:
„Endlich, endlich konnte meine Mutter jemandem ihre Geschichte erzählen. Jahrelang hat sie geschwiegen und sich geweigert über ihre Vergangenheit zu sprechen. Dabei sind wir so stolz und dankbar dafür, daß sie uns in ein gesichertes Leben geführt hat“.
Als David und ich uns von ihr verabschieden wollen, thront sie wieder in ihrem blaßgrünen Plastiksessel. Sie nimmt uns nicht wahr, „Sie schläft mit einem offenen Auge“, sagt David leise, als wir gehen.
Auf dem Weg nach Hause fragt mich David, ob mir aufgefallen ist, daß seine Mutter ihren Spucknapf nicht dabei hatte und ihn auch den ganzen Vormittag hindurch nicht gebraucht hat. Ich nicke stumm.
Nach einer Weile sagt David lächelnd: „Bei den Indianern gibt es Saugschamanen. Das sind Medizinmänner, die ihre Patienten so heilen, daß sie ihre von Krankheiten befallenen Körperstellen mit dem Mund ansaugen und die vermeintliche Krankheit dann ausspucken. Man kann es so sehen, daß meine Mutter kein Saugschamane sondern ein Spuckschamane ist. Sie heilt ihre eigenen Wunden so, daß sie ihre Vergangenheit ausspuckt. An Tagen, an denen die Erinnerungen sie besonders plagen, ist es richtig schlimm. Aber heute wird sie nicht mehr spucken müssen, denn sie hat Dir ja ihre Geschichte erzählt“.
Mehr zu mir selbst als zu David stelle ich laut die Frage, wie Gombutschka es mit ihren Erinnerungen aushält.
„Es gibt so viele Menschen, die in der Psychiatrie landen, wenn die bösen Erinnerungen sie quälen...“, sage leise ich zu David.
„Deine Mutter lebt in ihrer etwas seltsamen Welt, aber mit ihrem Mann, in ihrer eigenen Wohnung, das ist ein Glück. Du und Deine Geschwister und Eur Kinder, Ihr liebt sie, das sieht man schon an dem kleinen weißen Läufer an der Wohnzimmerwand, auf dem die Namen ihrer acht Enkel gestickt sind.“
„Diese Stickerei macht sie heute noch selbst und sie freut sich jedesmal wie ein Kind, wenn sie einen neuen Namen hinzufügen kann“, sagt David. „und außerdem: Vergiß nicht, sie ist ein Berserker.